Machina Sapiens
Buchvorstellung
© 2016
- 2025
Grundidee|
Einführung|
Der Autor Kazem Sadegh-Zadeh|
Kapitel 1: die These|
Kapitel 2: ein Selbstmissverständnis|
Kapitel 3: Vorausblick|
Kapitel 4: Was ist Leben?|
Kapitel 5: Die Idee der Bioevolution|
Kapitel 6: Evolutionssysteme|
Kapitel 7: Die Globalmaschine|
Kapitel 8: Die Technoevolution|
Kapitel 9: Die Machina Sapiens|
Kapitel 10: Nachwort|
Verwandte Ideen|
Der eindimensionale Mensch|
der Kybiont|
Metaman|
Global Brain|
Holismus|
Organische Theorie|
Soziointegrative Degeneration|
Kritik der Theorie der Machina sapiens|
1: unscharfer Begriff der Degeneration|
2: unklare Begründung einer Degeneration|
3: unklarer Begriff des Bewusstseins|
4: unklare Überprüfbarkeit von Degeneration|
5: warum global und nicht regional oder lokal?|
Würdigung der Theorie|
Was tun?|
Blog|
15. Juli 2025|
Fußnoten
Grundidee
Eine Dystopie aus dem Jahr 2000: Maschinen und Menschen verschmelzen zu einer weltweiten „Globalmaschine“, in der der Mensch dann seine Autonomie verliert. Eine lebendig bildhafte Sprache vermittelt ein plausibles Bild einer düster dystopischen Zukunft. Der Autor, geboren 1942 in Persien, war Professor an der Universität Münster und interessierte sich unter anderem für ethische Fragen. Sein Buch hat vor allem warnenden Charakter. Hier ist der Inhalt kurz kapitelweise skizziert, kommentiert und um Querverweise zu verwandten Ideen und Konzepten ergänzt.
Einführung
Rohstoffe lösen Kriege aus und entscheiden sie: als das Deutsche Reich 1941 die Sowjetunion angriff, war ein Ziel deutscher Außenpolitik der Zugriff auf die ukrainische Landwirtschaft. Ermutigt durch anfängliche große Erfolge, bemühte sich die deutsche Wehrmacht bald schon um die Besetzung der Ölfelder im fernen Kaukasus. England wiederum hatte schon Jahrzehnte vorher angefangen, den Irak mit einem Auge auf das dortige Öl unter seinen Einfluss zu bringen. Und während des Krieges versuchten die Allierten Engländer und Amerikaner abzuschätzen, ob Deutschland in seinem Machtbereich möglicherweise genug Uranerz zum Bau einer Atombombe haben könnte. [19] Rohstoffe zum Antrieb von Panzern und Flugzeugen oder zum Bau von Waffen waren in einem hohen Maße mit kriegsentscheidend.
An der großen Bedeutung von Rohstoffen für die Machtpolitik hat sich im folgenden Jahrhundert nichts geändert: im Jahr 2025 setzte China die Drosselung einer Ausfuhr seltener Erden und einiger anderer Rohstoffe wie Bismut oder Antimon als wirtschaftliche Waffe in einem Handelsstreit mit den USA ein. Gleichzeitig spielte die US-amerikanische Regierung mit dem Gedanken einer Annektion von Grönland und Kanada, beides Länder, in denen große Vorkommen der begehrten Rohstoffe vermutet werden oder bereits bekannt sind.
Das hier vorgestellte Buch beginnt mit dieser oft entscheidenden Rolle, die Rohstoffe in der Politik spielen. Doch der Autor sieht den Grund für den Hunger nach Rostoffen weniger in einem menschlichen Wunsch nach Macht, Reichtum, Einfluss oder militärischer Stärke. Der Autor sieht überhaupt den Menschen nicht als treibende Kraft sondern als getriebenen Handlanger einer gerade neu entstehenden hybriden Lebensform aus Menschen und Maschinen. Er nennt dieses Wesen die Machina sapiens. Und es sei diese Machina sapiens, die uns versklavt, um für sie die Rohstoffe der Erde heranzuschaffen.
Ich hatte von 2001 bis 2025 das Buch immer wieder neu gelesen. Über die Jahrzehnte erklärte es für mich immer besser das Selbstzerstörerische im menschlichen Handeln: Menschen sind Teil übergeordneter System, die eigenen Zielen folgen und durch ihre innere Struktur jeden ihrer Teil dazu bringen, sich diesen Zielen unterzuordnen. Für den Autoren sind vor allem sogenannte Hyperzyklen ein solch fataler Mechanismus.
Der Autor Kazem Sadegh-Zadeh
Kazem Sadegh-Zadeh wurde im Jahr 1942 im iranischen Täbris geboren und wuchs auch dort auf. Ab 1960 studierte er Medzin und Philosophie in Deutschland. Von 1984 bis 2004 hatte er eine Professur an der Universität Münster. Sadegh-Zadeh forderte unter anderem eine Präzisierung der medizinischen Fachsprache und den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Diagnose. Mehr zur Person unter 👉 Kazem Sadegh-Zadeh
Kapitel 1: die These
Im ersten Kapitel des Buches umreisst der Autor kurz seine These: auf der Erde vereinigen sich die „Biosphäre“ und die „Technosphäre“ zu einem „planetaren Riesenorganismus“, der „Machina sapiens“. Den technologischen Teil dieses Organismus nennt der Autor die „Globalmaschine“. Er kennt „vernetzte Nervengeflechte und Gehirne in Form von Computern“, „Sinnesorgane in Form von Sensoren, Telerezeptoren und Satelliten“ sowie auch „Effektoren in Form von mobilen Robotern und Fabriken“. Sadegh-Zadeh betrachte die Machina sapiens als „geistbegabt“, handelnd und lebendig.
Der Mensch wird in dieser „zwangsläufigen Symbiose mit der Technik“ immer mehr von „Sachzwängen“ dominiert. Die Technik ist immer weniger ein „außerkörperliches Organ“ des Menschen. Vielmehr ist der Mensch „in diesem Prozess von der Globalmaschine instrumentalisiert worden“.
Sadegh-Zadeh skizziert einen Prozess, den um 1980 der polnische Autor Stanislaw Lem in ähnlicher Weise anhand einer fiktiven Entwicklung des Militärwesens im 21ten Jahrhundert beschrieben hat: der Mensch degeneriert und wird dabei gleichzeitig Teil eines entstehenden höheren Organismus. Lem nannte diesen Prozess 👉 soziointegrative Degeneration (Soziologie)
Kapitel 2: ein Selbstmissverständnis
Die Ausbildung einer Machina sapiens betrachtet der Autor als eine „unabwendbare, naturgesetzliche Höherentwickung der Technik“. Die Menschheit ist dabei „versklavt“. Der Autor empfiehlt, dass man über „bessere Weisen der Koexistenz mit der Maschine“ nachdenken sollte.
Ein Selbstmißverständnis sieht der Autor darin, dass der Mensch bisher noch glaube „Herr der Technik und Vorsteher der Maschine“ zu sein. Diesen Gedanken hält Sadegh-Zadeh für einen wenig hilfreichen Mythos. Der Mensch hat den „Rollenwandel“ vom Herr zum Sklaven noch nicht erfasst. Alte Mythen handeln von der „Mittelpunkthaftigkeit des Menschen“, mit dem treffenden Sinnbild des geozentrischen Weltbildes. Siehe auch 👉 Anthropismus
Sadegh-Zadeh zitiert ein Buch [4] welches die geistige Sonderstellung des Menschen behauptet und jeder Maschinenintelligenz abspricht, den Menschen jemals überflügeln zu können. Demgegenüber sieht er einen „globalen Prozess des Überrollens des Menschen durch die belebte, intelligente und geistbegabte Maschine“, deren Geist aber „völlig andersartig“ ist und die wir deshalb „verkennen und übersehen“. Die Idee für uns unerkennbarer planetarer Intelligenzen ist auch Thema in Stanislaw Lems Roman 👉 Solaris
Das Kapitel 2 zweifelt vor allem eine irgendwie geartete Sonderstellung des Menschen im Universum an. Die Idee einer Besonderheit des Menschen in der Welt nennt man Anthropismus, die Gegenposition kann man bezeichnen als 👉 Indifferentismus
Kapitel 3: Vorausblick
Dieses Kapitel ist weniger als eine Seite lang. Es ist ein Vorausblick auf die kommenden Kapitel: dort erklärt werden sollen die nötigen Begriffe „Leben, Evolution, Koevolution, Hyperzyklus, Technosphäre, Bewußtsein und Geist“. Der Autor macht noch einmal sein Anliegen klar, den Menschen zu warnen vor seiner „erotischen Hingabe“ und „einseitigen Liebe“ mit der er die globale Maschine „emporpflegt“.
Kapitel 4: Was ist Leben?
Dieses Kapitel ist mit über 30 Seiten sehr lang und ausführlich. Es beginnt mit einigen Vexierbildern anhand derer der Leser für sich einüben soll, durch einen Wechsel seiner Perspektive ein und dasselbe Bild als verschiedene Gegenstände zu erkennen, zum Beispiel einen Hasen oder eine Ente. Mit diesem „Perspektivismus“ könne man dann auch Leben in Maschinen besser erkennen. Vor allem müsse man sich von der Idee lösen, dass Leben an Kohlenstoffverbindungen gebunden sei. Siehe auch 👉 Vexierbild
Zur Definition von Leben verwendet der Autor das Konzept eines Systems, bei dem „das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“, eine Sicht, die man in der Biologie auch Holismus nennt. Zudem seien Lebewesen „zyklische Kausalsysteme“, die man als gerichteten Graphen mit Knoten und Kanten darstellen kann. Siehe auch 👉 Holismus
Zyklisch sei als Kausalsystem zum Beispiel die Ausbildung von Emotionen im Gehirn eines Menschen, was Hormonausschüttungen bewirke, die dann wiederum auf die Emotionen zurückwirken können.
Azyklisch oder linear hingegen sei ein „Wolkenzusammenstoß“, der die Sackgassenprozesse Blitz, Donner und Regen hervorrufe. Zwar rufe der Regen dann auch Planzenwachstum und eine Ernährung der Tierwelt hervor, aber diese, so Sadegh-Zadeh, wirken nicht zurück auf einen Wolkenzusammenstoß. Hier muss kritisch angemerkt werden, dass Regen über vermehrte Verdunstung selbst wieder Wolkenbildung befördern kann und auch hier ein kausaler Zyklus gedacht werden könne.
Desweiteren wird Leben charakterisiert als ein „verteiltes System“, als System, das selbst als Komponenten wiederum Systeme hat. Durch Quervernetzungen entstehen letzendlich „unentwirrbare“ „Kausalknäuel“. Als Beispiele genannt werden die Struktur einer Regierung mit Kabinett und verschiedenen Ministerien sowie auch ein Organismus mit einem Verdauungssystem, Blutkreislauf, und Immunsystem.
Neben ihrer Verteiltheit als Systeme sind Lebewesen auch „autonome Produktionssysteme“. Sie stellen Produkte wie Früchte, Düfte, Kinder, Zellen, Kopfhaare, Wünsche, Gedanken oder Bücher her. Hier bringt der Autor auch Katalysatoren in den Gedankengang ein, Stoffe, die Prozesse „in Gang setzen“ oder beschleunigen. Siehe auch 👉 Katalysator
Die Autonomie sieht Sadegh-Zadeh als eine Folge autokatalytischer Vorgänge und der Organisationsform zylklischer Produktionssysteme sowie darin wirkender Regelkreisen, ähnlich einem Thermostat in Verbindung mit einer Heizung einer Wohnung. Über Regelkreise kann sich das Lebewesen an seine Umwelt „anpassen“, und ist damit „adaptiv“. Siehe dazu unter 👉 komplexes adaptives System
Im Zusammenhang mit der Autonomie von Systemen lässt Sadegh-Zadeh aber offen, was genau unter Kausalität zu verstehen. Schon durch die Verwendung aktiver Verben (zusammenarbeiten, verursachen, steuern, tun etc.) schreibt er seinen Systemen Handlungsfähigkeit zu. Kausalität als Idee von Ursache und Wirkung ist als physikalisch und philosophisch exakter Begriff seit etwa 1900 zunehmend schwerer haltbar geworden. Die Idee einer Kausalität wirft Fragen nach der kausalen Geschlossenheit von Systemen auf, nach der Eindeutigkeit von Wirkungen (Naturgesetze als Wahrscheinlichkeitsaussagen) und nach der Exaktheit der Definierbarkeit von Zuständen (z. B. Unschärferelation). Lies mehr zu den Problemen rund um den Kausalbegriff unter 👉 Kausalität
Die Fähigkeit zur Selbstreproduktion wird als letztes Kriterium von Leben besprochen. Lebewesen haben die Fähigkeit zur Selbstreproduktion mit geringen Abweichungen, Sadegh-Zadeh spricht von einer Quasiselbst-Reproduktion.
Abschließend wird eine Unterscheidung von Lebewesen erster und Lebewesen zweiter Ordnung eingeführt. Lebewesen erster Ordnung sind Lebensformen, die nur relativ zu ihrer Umwelt leben, etwa Viren, die in einer Umwelt als lebendig, in einer anderen per Definition tot sind. Diese Lebensdefinition ist „unscharf“: reproduktionsfähige Nukleinsäuren oder hirntote Menschen werden als Beispiele genannt. Als Beispiele für Lebewesen zweiter Ordnung werden Familien, Völker, Arten, Ameisenstaaten, Vogelschwärme und Ökoysteme genannt. Solche Lebewesen müssen nicht zwingend selbstreproduktiv sein. Lebewesen zweiter Ordnung seien aber - anders als individuelle Lebewesen erster Ordnung - fähig zur 👉 Evolution
Das Kapitel endet mit der Idee der Emergenz, dem Auftauchen von Eigenschaften eines Systems, das einzelnen Komponenten nicht zukommen kann: Zucker als Ganzes ist süß, nicht aber die Atome des Zuckers selbst. „Systemeigenschaften sind Eigenschaften eines Systems, nicht seiner Komponenten“. Damit spricht sich der Autor gegen eine engstirnig analytische Betrachtung aus und fordert, dass immer auch das System als Ganzes betrachtet werden müsse. Diese Herangehensweise nennt man auch Holismus. Eine emergente Eigenschaft der Machina sapiens, der „Koevolution zwischen Mensch und Technik“ ist die Degeneration des Menschen, also 👉 soziointegrative Degeneration
Kapitel 5: Die Idee der Bioevolution
In diesem kürzeren Kapitel werden Grundbegriffe der biologischen Evolution vorgestellt: präbiotische Evolution, Hyperzyklus, Mutation, Urzelle, Variation, Rekombination, Selektion, Population, Lamarckismus, Darwinismus etc. Siehe auch 👉 Evolution
Vor dem erdgeschichtlichen Rahmen einer biologischen Evolution glaubt Sadegh-Zadeh eine „Aufwärtsentwicklung“ von „weniger komplexen zu komplexeren“ Systemen zu erkennen. Er verwehrt sich aber dagegen, darin einen „moralischen Zug“ zu sehen, die Evolution an sich sei „amoralisch“. Zur Idee einer stetigen Höherentwicklung zum Komplexen siehe auch 👉 Metasystem-Transitionen
Kapitel 6: Evolutionssysteme
In diesem längeren Kapitel soll gezeigt werden, dass auch technische Systeme evolutionsfähig sein können. Sadegh-Zadeh erkennt ein „hybrides Ökosystem“ aus der „Biosphäre und Technik“, die gemeinsam „koevoluieren“. Zentral für das Kapitel ist die Idee einer Symbiose, wobei er Mutualismus (beiderseitiger Nutzen), Kommensalismus (einseitiger Nutzen aber ohne Schaden) und Parasitismus (einseitiger Nutzen mit Schaden) unterscheidet. Nach einigen Beispielen aus der Biologie (Baum-Pilz) wird gefragt, ob nicht auch der Mensch in einer Koevolution mit seinen Techniken steht. Indizien für eine solche Koevolution seien etwa Kanäle, Bergerwerke, die Landwirtschaft und Städte.
Zentral zur Erkennung der Koevolution von Mensch und Technik ist der Begriff des Hyperzyklus, nach Sadegh-Zadeh „ein ringförmiger Zusammenschluß von quasiselbstreproduktiven Populationen“.
Immer wieder - auch im Kapitel 6 - macht Sadegh-Zadeh sein zentrales Anliegen deutlich, nämlich die Erkenntnis, dass der Mensch in diesem Prozess eher Opfer als Handelnder ist. Er mahnt, daß „evolutionär optimal keinswegs 'moralisch' oder 'gut' bedeutet“ und dass die „hyperzyklischen Strukturen durch Opportunismus, Skrupellosigkeit und Unbarmherzigkeit gekennzeichnet“ seien. Produzieren Hyperzyklen neue Hyperzyklen, so kann man Sadegh-Zadeh zufolge von einer „Darwinmaschine“ sprechen. Damit deutet sich bereits der Begriff Globalmaschine an, der Gegenstand des folgenden Kapitels wird.
Kapitel 7: Die Globalmaschine
In den „Mühlen eines globalen Hyperzyklus“ ist eine „Technosphäre“ entstanden als deren Teil man eine Globalmaschine ausmachen kann: „Die Globalmaschine ... ist der technosphärische Anteil des Bio-Techno-Hyperzyklus“.
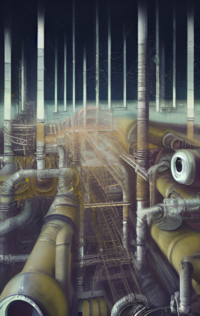
Die Globalmaschine umfasst die gesamte Welt. Der Mensch ist entweder verdrängt in die Rolle eines Cybersaprobionten oder er funktioniert als fremdbestimmtes, versklavtes Glied in der Eingeweiden der Globalmaschine.
Kapitel 8: Die Technoevolution
Das Kapitel beginnt mit der Idee evolutionsfähiger Maschinen. Hier wechselt Sadegh-Zadeh die Perspektive so, dass er zum Beispiel Automobilen eine Handlungsfähigkeit zuschreibt, ganz im Einklang mit dem Rest des Buches: „Mittels der Produktions- und Konsummaschinerie quasiselbstreproduziert sich ein Prototyp auf zwei Wegen“. Von einer horizontalen Selbstreproduktion ist die Rede, wenn etwa vier Millionen VW-Käfer des Baujahres 1986 hergestellt werden, von einer vertikalen Selbstreproduktion wenn es um nachfolgende Prototypen der kommenden Jahre geht. Der Auto unterstreicht explizit, dass die Spezies Automobil hier nicht als von Menschen „intendiert“, „geplant“ und „verwirklicht“ gesehen werden muss, sondern selbst „aktiv“ sein kann. Man kann sich in den „Maschinenprototyp hineinversetzen und die Welt aus dieser Perspektive betrachten“. Die „Produktions- und Konsummaschinerie“ erscheint dann als „externes Fortpflanzungsorgan“.
Sadegh-Zadeh bemerkt an dieser Stelle, dass die Reproduktion in der Technosphäre noch strikt „agenetisch“ erfolgt, merkt aber an, dass mit der Entwicklung der Biotechnologie auch genetische Elemente in das System eingetragen werden. Hier kann man ergänzen, dass zumindest Vorstufen einer genetischen Reproduktion in Unternehmen erkennbar sind: Normen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Patente, die Dokumentation von Prozessen (ISO 9000) könnten als Vorstufen einer genetischen RNA aufgefasst werden, die nämlich bei der Ausbildung neuer Unternehmen Merkmale schon bestehender Unternehmen weitergibt. Kettenunternehmen könnten als Populationen mit horizontalem Gentausch modelliert werden. Dieser Aspekt ist in dem hier vorgestellten Buch aber nicht weiter ausgearbeitet. Siehe dazu 👉 Evolutionsökonomik
Einen „Willen“ hat nach Sadegh-Zadeh weder die Einzelmaschine Auto, noch der Prototyp eines Modells, sondern nur die Globalmaschine. Er führt als Analogie auch den Hyperzyklus aus Blumen und Insekten an und man darf hier vermuten, dass der Autor auch diesem Hyperzyklus Geist oder Willen zuschreibt. Was zunächst wie eine Variante der Gaia-Hypothese (lebende Erde) klingt, geht aber darüber hinaus: die originale Gaia-Hypothese von James Lovelock unterstellte ausdrücklich nirgends Willen oder Geist. Genau diesen Aspekt möchte aber Sadegh-Zadeh in die von ihm beschriebenen Systeme hineinbringen. Siehe auch 👉 Gaia-Hypothese
Aus Sicht der Maschinenspezies wird die Technoevolution angetrieben von zwei Triebfedern: der Konkurrenz um Geld und der Konkurrenz um Erfüllung des „Lusthaushalts“ des Menschen: „Der Selektionsdruck, der dadurch für sie entsteht, liefert die treibende Kraft für die Technoevolution“. Sadegh-Zadeh spricht dann von einem Technotop, wo verschieden Maschinenarten oder Technika sich gemeinsam eine Umwelt teilen, etwa CD-Spieler und Videorekorder.
Technotope konkurrieren jedoch zunehmend mit Biotopen: „Abgase, Verklappungen, Atomtests, Flußbegradigung und -bedeichung, Straßenbau und Walrdodung“ gehen zunehmend auf Kosten des Biotops. Und auch sei die Technik nicht mehr nur abhängig vom Menschen sondern auch umgekehrt: es werden heute Kinder geboren, die ohne Technik nie lebend auf die Welt gekommen wären oder sich in ihr fortpflanzen könnten. Und: „Analog zu anderen anderen Makroprozessen der Natur wie etwa einer Kontinentaldrift oder einem Vulkanausbruch, fragen auch die Makroprozesse der Technoevolution als Natureignisse nicht erst den Menschen, ob sie sich ereignen dürfen...“ Der Mensch unterliege auch einer „Instrumentalsierung der miteinander konkurrierenden Staaten“. Die Staaten seien gezwungen zu einer „technophilen Gesetzgebung“, sie müssen ihre “Dörfer, Straßen, Häuser, Schulen und Kirchen maschinengerecht bauen“.
Die Globalmaschine ist nach Sadegh-Zadeh in dem Sinne autonom, dass sie vom Menschen nicht mehr gesteuert werden kann, sondern sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Bereis eine „Großmaschine“ wie die Deutsche Bahn oder die Chemie-Firma Bayer Leverkusen würden dem menschlichen Willen nicht gehorchen. Ganz im Gegenteil zwingt die Globalmaschine dem Menschen ihren Willen auf und zwar durch eine: „ubiquitäre Indoktrinierung, daß der technische Fortschritt notwendig sei“, dem „Bedürfnis nach Automobilität“ oder dem „Konsum von Massenmedien“. Der Autor spricht von einem „infektiösen Verlangen“. Siehe dazu auch 👉 Konsumismus
Ein „Opponent gilt als Träumer, als Spinner, Verräter, Abweichler und Krimineller“. „Der Staat fungiert als der große Organisator, Förderer und Organisator der Globalmaschine“. An anderer Stelle seines Buches [Seite 154] verweist Sadegh-Zadeh treffend auf Herbert Marcuses treffende Analysen in dem soziologischen Klassiker 👉 Der eindimensionale Mensch
Kapitel 9: Die Machina Sapiens
Mentale Zustände zu erkennen, so Sadegh-Zadeh, sei ein unlösbares Problem. Ob die Globalmaschine „Erleben, Bewußtsein, Selbstbewußtsein, Intelligenz, Denken“, „Geist“ oder „Psyche“ habe, sei nicht eindeutig zu beantworten. Man reisse damit das Leib-Seele-Problem an. Über eine Analogie möchte Sadegh-Zadeh dann zeigen, dass die Globalmaschine doch mentale Zustände haben könnte.
Man soll sich in einem Gedankenexperiment ein Gehirn so groß vorstellen wie eine Fabrik. Man kann dann darin umhergehen und sieht „Zellen, Zellfortsätze, Zellwände, Zellkerne, Zellmoleküle und andere Zellbestandteile. Aber wo ist das Bewußtsein, wo sind die Gefühle? Wo ist das Ich?“ Sadegh-Zadeh bezeichnet dieses Gedankenspiel als eine Leibniziade [5]. Während aber der Mathematiker und Philosoph Leibniz damit spöttisch zeigen wollte, dass bloße Bewegung und Physik nicht als Erklärung für Mentales tauge, will Sadegh-Zadeh Mentales als ein emergentes Phänomen seiner vorher definierten systemischen Eigenschaften sehen: „mentale Zustände eines geistbegabten Systems sind emergente Systemeigenschaften des Ganzen und folglich nicht Eigenschaften der intrasystemaren Komponenten.“ Wesentlich für Geist und Mentales sei die Fähigkeit sich selbst zu erkennen.
Sadegh-Zadeh bindet Bewusstsein letztendlich nicht an Gehirnstrukturen sondern sieht es als Ausdruck eines Gesamtorganismus. Wo der Organismus innen ein Bild von sich erzeugen kann, kann er selbstbewusst werden. Zur Klärung entlehnt er den Begriff des Endomorphismus aus der Geologie: „ein Endomorphismus ist eine gewisse Sorte von Abbildung eines Systems in sich selbst.“ Diesen Begriff differenziert er dann weiter stark systemisch argumentierend aus. Und so gesteht er auch seiner weltweiten Machina sapiens Geist und Bewusstsein zu.
Als „Gehirn und Nervenetz der Globalmaschine“ versteht Sadegh-Zadeh „die Myriaden der weltweit miteinander vernetzten Computer und Sensoren“, die er das Globalnet nennt. „Die Machina sapiens ist die durch das Globalnet geistbegabte Globalmaschine“. Die Erde wird so zu einem „intelligenten Planeten“, mit dem Menschen als nicht mehr als einem „Cybersaprobiont“. Siehe auch 👉 Global Brain
Kapitel 10: Nachwort
Hier gibt Sadegh-Zadeh Einblicke in die Entstehungsgeschichte seiner Theorie, die Zeit von 1986 bis 1988. Ausgangspunkt waren die erschütternden politischen Ereignisse in seiner Heimat um den Iran und Irak. Der gängigen Deutung, dass dahinter politische Interessen um billiges Erdöl stünden, stellte sich plötzlich die Erkenntnis bei, dass hier ein globales Wesen wirken könnte, dass seinen Hunger nach Öl stillen möchte.
Sadegh-Zadeh zitiert unter anderem den Wissenschaftstheoretischer Ludwik Fleck [6] und charakterisiert eine Theorie als „Begriffskonstrukt“ und nicht als etwas das als Ganzes wahr oder falsch sein soll. Ziel sei es, eine Theorie mit Nutzen anzuwenden und zu gebrauchen. Einen solchen Nutzen sieht Sadegh-Zadeh darin, die eigenen Situation als eine Versklavung durch die Globalmaschine zu erkennen. Er warnt vor einer „Emigration der Vernunft“, nämlich von den Köpfen der Menschen hinein ins Internet mit „Expertensystemen“, „künstlicher Intelligenz“ und „knowledge discovery“. Sadegh-Zadeh prophezeit eine Zeit „wo die Tätigkeit des Menschen nur noch darin bestehen wird, die Globalmaschine zu bedienen ... er wird mittels ubiquitäter Sprechanlagen und transportabler Handys in das Internet nur noch sprechen, um seine Wünsche erfüllt zu bekommen.“ Und: „Er wird nur noch in den Fernseher starren ... um Produkte wie Big Brother zu genießen ... und er wird immer noch nicht wahrnehmen, wie weit er gekommen, zurückgeschritten, aufgestiegen oder gefallen ist. Denn er wird nicht verstehen, daß hier eine Frage besteht.“
Verwandte Ideen
Kazem-Sadegh Vorstellung eines globalen Überorganismus steht in einer langen Tradition ähnlicher systemisch gedachter Zukunftsentwürfe.
Der eindimensionale Mensch
Im Nachwort zu seinem Buch erwähnt Zadegh-Sadeh speziell in seiner Studentenzeit um 1968 zwei Bücher von Herbert Marcuse gelesen zu haben, darunter auch den Klassiker "Der eindimensionale Mensch". [18] Ein gemeinsamer Gedanken, der sich in den Büchern von Marcuse genaus wie auch in der Machina sapiens findet, ist die scheinbar widersprüchliche Bindung der Menschen an von ihnen selbst geschaffene und betriebene Mechanismen der Ausbeutung. Während Zadegh-Zadeh aber systemtheoretisch und naturwissenschaftlich argumentierte, war der Denkstil Marcuses durch und durch soziologisch. Siehe mehr unter 👉 der eindimensionale Mensch

