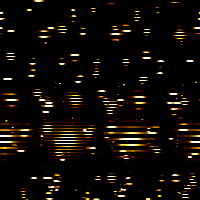Welle-Teilchen-Dualismus
Quantenphysik
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Was sind Teilchen?|
Wie verhalten sich Wellen?|
Was ist wellenartig an Teilchen?|
Klassische Experimente|
Das Doppelspaltexperiment|
Der Ramsauer-Effekt|
Die Beugung von Elektronen|
Eddingtons Sirius-Paradaxon|
Nach welche Kriterien wählt man das Modell?|
1927, Ko-Existenz der Modelle?|
Eine Kritik des Begriffes Welle-Teilchen-Dualismus|
Tipps|
Fußnoten
Basiswissen
In vielen Physik-Lehrbüchern wird beschrieben, dass Quantenobjekte sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften haben. So kann Licht manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen betrachet werden. Diese Doppelnatur des Licht ist schon seit dem 17ten Jahrhundert bekannt[3][4] und gilt bis heute als nicht befriedigend erklärt.[8][10]
Was sind Teilchen?
Elektronen oder Protonen haben eindeutig Teilchencharakter. Teilchen sind in der Physik durch besondere Eigenschaften charaktisiert:
- Sie haben eine Masse, zum Beispiel gemessen in Gramm oder Kilogramm.
- Sie folgen Newtons erstem Axiom: ohne äußere Kräfte fliegen sie geradeaus
- Zu Newtons erstem Axiom gehört noch: ohne äußere Kräfte bleibt v konstant.
- Sie sind räumlich sehr eng begrenzt, ihre Ränder zerfließen nicht.[7]
- Teilchen können sich gegenseitig nicht durchdringen.
- Stoßen Teilchen aneinander, können sie sich verbinden ...
- oder aber sie prallen nach den Stoßgesetzen voneinander ab.
- Bewegte Teilchen haben einen Impuls, den sie auch übertragen können Impuls ↗
- Mehr dazu unter Teilchen ↗
Wie verhalten sich Wellen?
Wellen sind etwas ganz anderes als Teilchen. Man kann sich zum Beispiel eine Wasserwelle in einem Wellenbad vorstellen. Typische Eigenschaften von Wellen sind:
- Wellen sind räumlich nicht eng lokalisiert, sie sind räumlich ausgedehnt.[7]
- Wellen können sich räumlich durchrdringen, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.
- Wellen können bei einer Durchdringung Interferenzeigenschaften zeigen.
- Bei Wellen bewegt sich in Ausbreitungsrichtung netto keine Masse.
- Bei Wellen schwingen lediglich Oszillatoren um ihre Ruhelage.
- Klassische Wellen transportieren keinen Impuls.
- Wellen breiten sich nicht geradlinig aus.
- Mehr dazu unter Welle ↗
Was ist wellenartig an Teilchen?
Die Erscheinung einzelner Quantenobjekte (Photonen, Elektronen) ist immer teilchenartig: Photonen oder Elektronen werden als eng umgrenzte Flecken auf Schirmen beobachtet, niemals als ausgedehntes Wellenbild. Die Teilchen selbst sind NICHT wellenartig. Der Wellencharakter bezieht sich korrekt gesehen nur auf die Formeln, die zur Berechnung von Beobachtungswahrscheinlichkeiten dienen. Wenn man von einer Teilchenfrequenz oder der Wellenlänge eines Teilchens spricht, dann meint das nur: in den Formeln zur Berechnung der Erscheinungsorte dieser Teilchen zu bestimmten Zeiten werden Frequenzen und Wellenlängen eingesetzt. Mehr dazu unter Teilchenwelle ↗
Klassische Experimente
Das Doppelspaltexperiment
Das sogenannte Doppelspaltexperiment aus dem frühen 19ten Jahrhundert ist DAS Experiment der Quantenphysik: man lässt Licht durch Öffnung in einer Wand auf eine gegenüberliegende Wand fallen. Die dortigen Schattenmuster passen überhaupt nicht auf die Idee von Licht als Teilchen. Sie lassen sich aber perfekt vorhersagen, wenn man Licht als etwas Wellenartiges denkt. Aber dennoch: wenn man das auftreffende Licht auf geeignete Weise sichtbar macht, scheinen doch wieder nur Teilchen anzukommen, keine Wellen. Siehe mehr dazu unter Doppelspaltexperiment ↗
Der Ramsauer-Effekt
Im Jahr 1920 veröffentlichte Carl Ramsauer, in der NS-Zeit später der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Ergebnisse eines Experiments, die einfach falsch sein mussten: wenn Elektronen nur langsam genug fliegen, dann können sie sehr viele größere Moleküle von Gasen geradewegs durchfliegen. In der klassischen Vorstellung von Elektronen und Molekülen als Stückchen aus undurchdringbarer Materie war das unmöglich. In der Vorstellung von Materie als etwas Wellenartiges aber schienen die Ergebnisse vernünftig. Siehe mehr unter Ramsauer-Effekt ↗
Die Beugung von Elektronen
Im Jahr 1927 konnten amerikanische Physiker zeigen, dass sich nicht nur Photonen, die gedachten Teilchen des Lichts, wie Wellen verhalten können. Auch Elektronen, die ja eine bekannte Masse besitzen, haben Eigenschaften von Wellen. Damit konnte man dann auch rückblickend den Ramsauer-Effekt von 1920 verständlich machen. Die Elektronen haben einerseits eine bestimmte Masse, sind gleichzeitig aber auch wellenhaft. Siehe mehr unter Davisson-Germer-Experiment ↗
Eddingtons Sirius-Paradaxon
Der englisch Astrophysiker Arthur Eddington zeigte an einem eindrucksvollen Gedankenexperiment, wie sehr sich das Wellen- und das Teilchenmodell ausschließen: vom Stern Sirius wird ein Lichtwelle ausgesendet. Diese Lichtwelle breitet sich in Kugelform im Weltraum aus. Acht Jahre und neun Monate später blickt ein Mensch auf der Erde in den Himmel und sieht den Sirius. Just in diesem Modell erreicht die Welle sein Auge. Auf einen Schlag wird die gesamte Wirkung dieser Welle in einem einzigen Quant auf ein Atom im Auge des Beobachters übertragen. An dieser Stelle der Geschichte fragt Eddington, wie das sein kann: "Sendet das Wellengekräusel, welches das Auge erreicht, eine Botschaft an die anderen Teile der Welle: wir haben ein Auge gefunden, lasst uns hier zusammenkomen!"[13]
Nach welche Kriterien wählt man das Modell?
- Nach der de-Broglie-Wellenlänge:
- Wellenlänge = Planck-Konstante durch Impuls
- Man kann damit rechnerisch jeder Masse eine Wellenlänge zuordnen.
- Ist diese Wellenlänge sehr klein im Verhältnis zur Teilchengröße, ...
- dann passt das Teilchenmodell sehr gut (z. B. für Golfbälle).
- Ist die Wellenlänge eher groß im Verhältnis zur Ausdehnung des Objektes, ...
- dann passt besser die Wellenvorstellung.
- Mehr dazu unter de-Broglie-Wellenlänge ↗
1927, Ko-Existenz der Modelle?
In den 1920er Jahren, der Pionierzeit der Quantenphysik, begann zunehmend den Wellen- und den Teilchencharakter von Dingen parallel nebeneinander bestehen zu lassen. Ein Denker jener Zeit schreibt dazu passend:
ZITAT:
"Um die Widersprüche zu beseitigen, die die Quantentheorie in ihrer ursprünglichen Form aufweist, scheint es notwendig zu sein, den diskontinuierlichen materiellen Teilchen (Elektronen und Protonen) kontinuierliche Wellen von noch schlecht definierter Natur zuzuordnen und die ballistische Mechanik durch eine Wellenmechanik zu ersetzen, wie einst die geometrische Optik durch die Wellenoptik, allerdings ohne den Begriff individueller materieller Teilchen aufzugeben. [...] Es ist Louis de Broglie zu verdanken, dass er dieses revolutionäre Konzept eingeführt hat, das in Deutschland von Schrödinger wieder aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Stabile stehende Wellen um den Kern eines Atoms würden durch ihre Schwingungen die charakteristischen Frequenzen der Lichtemissionen des Atoms erklären. Sogar die paradoxe Schlussfolgerung, dass in der Nähe des Kerns der wellenförmige Aspekt des Phänomens zu dominieren scheint; die Individualität des Elektrons, die wir so direkt beobachten, wenn es frei ist, scheint dann zu verschwinden, sich in ein kontinuierliches System stehender Wellen aufzulösen."[14]
"Um die Widersprüche zu beseitigen, die die Quantentheorie in ihrer ursprünglichen Form aufweist, scheint es notwendig zu sein, den diskontinuierlichen materiellen Teilchen (Elektronen und Protonen) kontinuierliche Wellen von noch schlecht definierter Natur zuzuordnen und die ballistische Mechanik durch eine Wellenmechanik zu ersetzen, wie einst die geometrische Optik durch die Wellenoptik, allerdings ohne den Begriff individueller materieller Teilchen aufzugeben. [...] Es ist Louis de Broglie zu verdanken, dass er dieses revolutionäre Konzept eingeführt hat, das in Deutschland von Schrödinger wieder aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Stabile stehende Wellen um den Kern eines Atoms würden durch ihre Schwingungen die charakteristischen Frequenzen der Lichtemissionen des Atoms erklären. Sogar die paradoxe Schlussfolgerung, dass in der Nähe des Kerns der wellenförmige Aspekt des Phänomens zu dominieren scheint; die Individualität des Elektrons, die wir so direkt beobachten, wenn es frei ist, scheint dann zu verschwinden, sich in ein kontinuierliches System stehender Wellen aufzulösen."[14]
Einem Elektron, das sich außerhalb eines Atoms bewegt eine Individualität zuzuschreiben, die es aber verliert, wenn es im Atom ist, kann schnell unseren Wunsch überfordern, dass wir uns die Welt im Kleinen wie die Welt im Großen nur eben verkleinert vorstellen wollen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Welt im Kleinen eben nicht nur eine miniaturisierte Welt unserer Alltagserfahrung ist. Dennoch: Bohr warb davor, die konkurrierenden Modelle von Welle und Teilchen friedlich nebeneinander koexstieren zu lassen. Diese Haltung charaktersierte Bohr gerne mit seinem Begriff der Komplementarität ↗
Eine Kritik des Begriffes Welle-Teilchen-Dualismus
Photonen, Elektronen, Atome und auch größere Gebilde wie Moleküle[11] zeigen eindeutig Wellen- wie auch Teilcheneigenschaften. Obwohl beide Denkbilder theoretisch unvereinbar sind[6], treten sie in der Wirklichkeit doch gemeinsam auf. Nach den gängigen Definitionen eines Dualismus[1] müssen sich zwei Dinge aber gegenseitig ausschließen oder zumindest bekämpfen, auf keinen Fall aber ergänzen zu einem stimmigen, harmonischen Gesamtbild. Spricht man also von eine Welle-Teilchen-Dualismus meint man damit eigentlich, dass sich die zwei Beschreibungen gegenseitig ausschließen sollen. Das tun sie aber nicht, so kann der Widerspruch beispielsweise durch die Bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation auch theoretisch aufgehoben werden. Der Pionier der Quantenphysik, Niels Bohr, wies immer wieder auf die gegenseitige Bedingtheit beider Beschreibungsweisen hin und sprach entsprechend nicht von einem Dualismus sondern von einer Komplementarität.
Tipps
- Wenn man Teilchen misst, zeigen sie immer Teilchencharakter.
- Wenn man ihre Zustandsänderungen berechnet, passt eher der Wellencharakter.
- Der Wellencharakter beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen.
- Siehe auch Bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation ↗
Fußnoten
- [1] Dualismus. In: Metzeler Philosophie Lexikon. Herausgegeben von Peter Prechtl und Franz-Peter Burkard. 2. überarbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar, 1999. ISBN: 3-476-01679-X. Seite 120.
- [2] Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Tscharnak. Verlag von J. C. B. Mohr. Tübingen. 1931. Band I. Seite 2033.
- [3] Newton sprach von Licht als Strahlen (rays), die man sich teilchenartig vorstellen kann: "A transparent Body which looks of any Colour by transmitted Light, may also look of the same Colour by reflected Light, the Light of that Colour being reflected by the farther Surface of the Body, or by the Air beyond it. And then the reflected Colour will be diminished, and perhaps cease, by making the Body very thick, and pitching it on the backside to diminish the Reflexion of its farther Surface, so that the Light reflected from the tinging Particles may predominate. In such Cases, the Colour of the reflected Light will be apt to vary from that of the Light transmitted. But whence it is that tinged Bodies and Liquors reflect some sort of Rays, and intromit or transmit other sorts, shall be said in the next Book. In this Proposition I content my self to have put it past dispute, that Bodies have such Properties, and thence appear colour'd." In: Isaac Newton: OPTICKS: OR, A TREATISE OF THE Reflections, Refractions, Inflections and colours OF LIGHT. The_ FOURTH EDITION, corrected. By Sir ISAAC NEWTON, Knt. LONDON: Printed for WILLIAM INNYS at the West-End of St. Paul's. MDCCXXX (1730).
- [4] Newton sah eine enge Verbindung der Lichtteilchen (rays) zu Wellenartigen Phänomenen: "If a stone be thrown into stagnating Water, the Waves excited thereby continue some time to arise in the place where the Stone fell into the Water, and are propagated from thence in concentrick Circles upon the Surface of the Water to great distances. And the Vibrations or Tremors excited in the Air by percussion, continue a little time to move from the place of percussion in concentrick Spheres to great distances. And in like manner, when a Ray of Light falls upon the Surface of any pellucid Body, and is there refracted or reflected, may not Waves of Vibrations, or Tremors, be thereby excited in the refracting or reflecting Medium at the point of Incidence, and continue to arise there, and to be propagated from thence as long as they continue to arise and be propagated, when they are excited in the bottom of the Eye by the Pressure or Motion of the Finger, or by the Light which comes from the Coal of Fire in the Experiments above-mention'd? and are not these Vibrations propagated from the point of Incidence to great distances? And do they not overtake the Rays of Light, and by overtaking them successively, do they not put them into the Fits of easy Reflexion and easy Transmission described above? For if the Rays endeavour to recede from the densest part of the Vibration, they may be alternately accelerated and retarded by the Vibrations overtaking them." In: Isaac Newton: OPTICKS: OR, A TREATISE OF THE Reflections, Refractions, Inflections and colours OF LIGHT. The_ FOURTH EDITION, corrected. By Sir ISAAC NEWTON, Knt. LONDON: Printed for WILLIAM INNYS at the West-End of St. Paul's. MDCCXXX (1730).
- [5] Der Physiker Richard Feynman verdeutlicht den Dualismus von Wellen- und Teilchenmodell am Beispiel von Elektronen. Er weist zunächst darauf hin, wass Elektronen stets nur in Klumpen (lumps) beobachtet werden: "We conclude, therefore, that whatever arrives at the backstop arrives in “lumps.” All the “lumps” are the same size: only whole “lumps” arrive, and they arrive one at a time at the backstop. We shall say: “Electrons always arrive in identical lumps." Wo sie in Experimenten gemessen werden, wird jedoch von Wellengleichungen bestimmt: "We conclude the following: The electrons arrive in lumps, like particles, and the probability of arrival of these lumps is distributed like the distribution of intensity of a wave. It is in this sense that an electron behaves sometimes like a particle and sometimes like a wave.” In: The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Mainly mechanics, radiation, and heat. Feynman • Leighton • Sands. Dort das Kapitel 37: Quantum behaviour. Online: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_37.html
- [6] Der Welle-Teilchen-Dualismus der Quantenphysik, in den Worten von Niels Bohr: "In the attempts to give a theoretical interpretation of the mechanism of interaction between radiation and matter, two apparently contradictory aspects of this mechanism have been disclosed. On the one hand, the phenomena of interference, on which the action of all optical instruments essentially depends, claim an aspect of continuity of the same character as that involved in the wave theory of light, especially developed on the basis of the laws of classical electrodynamics. On the other hand, the exchange of energy and momentum between matter and radiation, on which the observation of optical phenomena ultimately depends, claims essentially discontinuous features. These have even led to the introduction of the theory of light-quanta, which in its most extreme form denies the wave constitution of light." In: Niels Bohr, Kramers, H. A. and Slater, J. C.: The quantum theory of radiation. In: Philosophical Magazine Series 6, 47: 281, 785 — 802. DOI: 10.1080/14786442408565262. Online: https://uni-tuebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/MathePhysik/Institute/IAP/Forschung/MOettel/Geburt_QM/bks_PhilMag_47_785_1924.pdf
- [7] In seiner bahnrechenden Veröffentlichung über Lichtquanten aus dem Jahr 1905 stellt Albert Einstein am Anfang erst die Wellentheorie des Lichts im Sinn elektromagnetischer Strahlung vor. Dabei betont er, dass sich dieser Theorie zufolge Licht als "kontinuierliche Raumfunktion" aufzufassen ist. Diese "Undulationstheorie", so Einstein, habe "sich zur Darstellung der rein optischen Phänomene vortrefflich bewährt". Aber, so Einstein weiter, ist es jedoch "im Auge zu behalten, dass sich die optischen Beobachtungen auf zeitliche Mittelwerte, nicht aber auf Momentanwerte beziehen". Diese Theorie aber könne zu "Widersprüchen" führen, wenn man bestimmte Vorgänge der "Lichterzeugung" und "Lichtverwandlung" betrachtet. Einstein: "Es scheint mir nun in der Tat, daß die Beobachtungen über die 'schwarze Strahlung', Photoluminiszenz, die Erzeugung von Kathodenstrahlen durch ultraviolettes Licht und andere die Erzeugung bez. Verwandlung des Lichtes betreffende Erscheinungsgruppen besser verständlich erscheinen unter der Annahme, daß die Energie des Lichtes diskontinuierlich im Raume verteilt sei. Nach der hier ins Auge zu fassenden Annahme ist bei Ausbreitung eines von einem Punkte ausgehenden Lichtstrahles die Energie nicht kontinuierlich auf größer und größer werdene Räume verteilt, sondern es besteht dieselbe aus einer endlichen Zahl von in Raumpunkten lokalisierten Energiequanten, welche sich bewegen, ohne sich zu teilen und nur als Ganze absorbiert und erzeugt werden können." Albert Einstein: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. In: Annalen der Physik. Band 322, Nr. 6, 1905, S. 132–148, doi:10.1002/andp.19053220607. Dort die Seite 13r3. Online: http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf
- [8] Das Spektrum Lexikon der Astronomie konstatiert: "Die Wellenfunktion, üblicherweise symbolisiert durch den griechischen Buchstaben Ψ, beschreibt in der Quantentheorie ein mikroskopisches Teilchen." und räumt aber zur Wellenfunktion auch ein: "sie muss aber noch geeignet interpretiert werden". In: der Artikel "Wellenfunktion". Spektrum Lexikon der Astronomie. Abgerufen am 2. Juni 2024. Online: https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/wellenfunktion/526
- [9] Dem Physiker Erwin Schrödinger (1887 bis 1961) zufolge, ist die Vereinigung von Wellen- und Teilchenbild niemals befriedigend gelungen. Nachdem er ausführlich die Richtigkeit des Wellen- sowie auch des Teilchenbildes dargelegt hat, fährt er fort: "Dabei ist der Zusammenhang der beiden Bilder in voller Allgemeinheit, mit großer Klarheit und bis zu erstaunlichen Einzelheiten bekannt. An seiner Richtgkeit und Allgemeingültigkeit zweifelt niemand. Bloß über die Vereinigung zu einem einzigen, konkreten, handgreiflichen Bilde sind die Meinungen so sehr geteilt, daß sehr viele dies überhaupt für unmöglich halten. Ich werde den Zusammenhang jetzt kurz umreißen. Aber rechnen sie nicht damit, daß Ihnen daraus solch einheitliches konkretes Bild erwachse; und schieben Sie es weder auf mein Ungeschick in der Darstellung noch auf Ihre eigene Begriffsstutzigkeit, daß das nicht gelingen wird - denn es ist bisher noch niemandem gelungen." In: Erwin Schrödinger: Was ist ein Naturgesetz? Beiträge zum naturwissenschaftlichen Weltbild. Scientia Nova. Oldenbourg. 2008. ISBN 978-3-486-58671-8. Dort im Abschnitt "Wellenfeld und Partikel: ihr theoretischer Zusammenhang" auf Seite 112.
- [10] Auch der Naturphilosoph Meinard Kuhlmann sieht Wellen und Teilchen noch nicht in einem gemeinsamen Bild vereinigt: "Sowohl in der Teilchen- wie in der Feldinterpretation der Quantenphysik werden die vertrauten Begriffe »Teilchen« und »Feld« derart weit gefasst, dass sich allmählich die Meinung durchsetzt, die Welt könnte aus etwas ganz anderem bestehen." Und: "Die fundamentalsten Objekte lassen sich nicht wie Alltagsdinge beschreiben, sondern als Bündel von Eigenschaften wie Form und Farbe, Masse und Ladung." Und: "wenn die von den Wörtern »Teilchen« und »Feld« wachgerufenen Vorstellungen nicht zutreffen, müssen Physiker und Philosophen sich darüber klar werden, was an ihre Stelle treten soll." In: Meinard Kuhlmann: Was ist real? Spektrum der Wissenschaft. Juli 2014. Siehe auch Meinard Kuhlmann ↗
- [11] Arndt, M., O. Nairz, J. Vos-Andreae, C. Keller, G. van der Zouw und A. Zeilinger (1999): Wave-particle duality of C60 molecules. Nature 401 (6754), S. 680–682.
- [12] Karl Raimund Popper: Die Quantentheorie und das Schisma der Physik. Mohr Siebeck, Tübingen. 2001. Zuerst auf Englisch niedergeschrieben im Jahr 1955.
- [13] Zum Eddington-Paradoxon des Welle-Teilchen Dualismus: "Conflict with the Wave-Theory of Light. The pursuit of the quantum leads to many surprises; but probably none is more outrageous to our preconceptions than the regathering of light and other radiant energy into h-units, when all the classical pictures show it to be dispersing more and more. Consider the light-waves which are the result of a single emission by a single atom on the star Sirius. These bear away a certain amount of energy endowed with a certain period, and the product of the two is h. The period is carried by the waves without change, but the energy spreads out in an ever-widening circle. Eight years and nine months after the emission the wave-front is due to reach the earth. A few minutes before the arrival some person takes it into his head to go out and admire the glories of the heavens and—in short—to stick his eye in the way. The light-waves when they started could have had no notion what they were going to hit; for all they knew they were bound on a journey through endless space, as most of their colleagues were. Their energy would seem to be dissipated beyond recovery over a sphere of 50 billion miles' radius. And yet if that energy is ever to enter matter again, if it is to work those chemical changes in the retina which give rise to the sensation of light, it must enter as a single quantum of action h. Just 6·55 . 10⁻²⁷ erg-seconds must enter or none at all. Just as the emitting atom regardless of all laws of classical physics is determined that whatever goes out of it shall be just h, so the receiving atom is determined that whatever comes into it shall be just h. Not all the light-waves pass by without entering the eye; for somehow we are able to see Sirius. How is it managed? Do the ripples striking the eye send a message round to the back part of the wave, saying, "We have found an eye. Let's all crowd into it!" In: Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort die Seiten 185 und 186. Online: https://gutenberg.ca/ebooks/eddingtona-physicalworld/eddingtona-physicalworld-01-h-dir/eddingtona-physicalworld-01-h.html
- [12] C. Davisson, L. H. Germer: Diffraction of Electrons by a Crystal of Nickel. In: Phys. Rev. Band 30, 1927, S. 705–740. Siehe auch Davisson-Germer-Experiment ↗
- [13] Der Denker war ein französischer Mathematiker. Im französischen Original lautet das Zitat: "Une révolution analogue, mais inverse, est en train de transformer notre conception de la matière. Pour lever les contradictions que présente la théorie des quanta sous sa forme primitive il semble nécessaire d'associer aux grains matériels discontinus (électrons et protons) des ondes continues de nature encore mal définie et de remplacer la mécanique balistique par une mécanique ondulatoire comme autrefois l'optique géométrique par l'optique ondulatoire, cela sans pourtant abandonner la notion de particules matérielles individuelles. Ici Fresnel vient au secours de Newton. C'est à Louis de Broglie que nous devons l'introduction de cette conception révolutionnaire, reprise et développée en Allemagne par Schrödinger Des ondes stationnaires stables autour du noyau d'un atome expliqueraient par leurs battements les fréquences caractéristiques des émissions lumineuses de l'atome. Même, conclusion paradoxale, au voisinage du noyau, c'est l'aspect ondulatoire du phénomène qui paraît prédominer ; l'individualité de l'électron, que nous observons si directement quand il est libre, semble alors s'évanouir, se fondre dans un système continu d'ondes stationnaires." In: Paul Painlevé: Les conceptions modernes de la matière et la science classique. Discours prononcé à Londres, le 15 novembre 1927 devant la « Royal Institution of Great Britain. Eine kurze Zusammenfassung des Vortrages wurde 1927 in Nature veröffentlicht: [News and Views]. Nature 120, 777–781 (1927). Für eine volle Textversion siehe auch Materie und klassische Physik (Vortrag) ↗