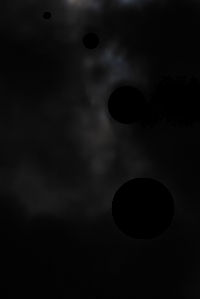Determinismus
Weltprozess
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Determinismus in der Mythologie|
Determinismus in der Theologie|
Determinismus in der Mathematik|
Determinismus in der klassischen Physik|
Determinismus in der Quantenphysik|
Der Laplace-Dämon als deterministischer Quälgeist|
Determinismus als Weltanschauung und Lebenshaltung|
Zur Aktualität des Determinismus|
Fußnoten
Basiswissen
Alles in der Welt ist determiniert, das heißt vorherbestimmt: die Naturgesetze bestimmen jede noch so kleine Entwicklung, Gott weiss schon seit der Schöpfung, wie die Welt ablaufen wird oder alles läuft nach den strengen Gesetzen eines Karmas ab: deterministische Positionen finden sich in verschiedenen Religionen und Weltbildern. Dazu stehen hier kurz vorgestellt einige typ
Determinismus in der Mythologie
Mythologien kennen verschiedene schicksalsbestimmende Mächte. Diese können unpersönlich gesetzmäßig sein, wie etwa das Gesetz des Karma im Buddhismus oder auch personifiziert wie die griechischen Moiren oder die altnordischen 👉 Nornen
Determinismus in der Theologie
In der christlichen Theologie gibt es deterministische Denkrichtungen. Sie folgen sozusagen als logische Konsequenz aus der Annahme eines allwissenden (omniszienten) Gottes. Denn: ist Gott allwissend, dann sieht er zukünftige Geschehen voraus, was heute schon was in 1000 Tagen passiert. Damit ist das Geschehen der Zukunft durch Gottes Allwissenheit vollständig determiniert. Dieser Gedanke geht bis auf die Früzeit des Christentums zurück [1], wurde im Mittelalter weiter unteruscht [2] Mit großer Konsequenz ausgearbeitet wurde dieser Gedanke als sogenannte 👉 Prädestinationslehre
Determinismus in der Mathematik
Wenn man etwas vollständig vorausberechnen kann, dann ist es determiniert. Dieser Gedanke ist richtig. Aber der Umkehrschluss gilt nicht zwingend. Wenn etwas determiniert ist, ist es nicht automatisch vorausberechenbar. Das klassische Beispiel dazu sind manche Zellularautomaten. Der englische Mathematiker Roger Penrose hat das Konzept der Berechenbarkeit detailliert ausgearbeitet. Ihm zufolge die mathematische Berechenbarkeit bedeutsam für die Rolle des Bewusstsein in Gehirnen. Umfangreich dargestellt ist diese Idee in dem sehr gut lesbaren Buch 👉 Computerdenken
Determinismus in der klassischen Physik
Die Physik sucht nach mathematisch fassbaren Zusammenhängen, sogennanten Korrelationen in der Welt. Das meint: wenn man jetzt ein Zustand genau kennt, dann kann man daraus einen zukünftigen Zustand genau voraussagen [9]. Der Nobelpreisträger und Physiker Richard Feynman sagte sinngemäß: Das höchste Wahrheitskriterium der Physik ist die Vorhersagbarkeit [8].
ZITAT:
"Wollen wir uns die objektive Notwendigkeit alles Geschehens, des physikalischen wie des praktischen, unter einem einfachen Bilde vorstellen, so tun wir vielleicht gut daran, an das Fallen der Flocken bei einem Schneegestöber zu denken. Notwendig, unentrinnbar notwendig ist nach Ort und Zeit die Bildung jedes einzelnen der Milliarden von Schneekristallen, ebenso notwendig ist die Anhäufung der Flocken, ebenso notwendig der Weg jeder Flocke von der Schneewolke bis zur Erdoberfläche. Dichtigkeit und Wärme der Luftschichten, der Wind und möglicherweise noch andre Energien bestimmen den Weg. Jede Schneeflocke muß zuletzt auf den Zweig niedersinken, auf dem sie liegen bleibt." [10]
"Wollen wir uns die objektive Notwendigkeit alles Geschehens, des physikalischen wie des praktischen, unter einem einfachen Bilde vorstellen, so tun wir vielleicht gut daran, an das Fallen der Flocken bei einem Schneegestöber zu denken. Notwendig, unentrinnbar notwendig ist nach Ort und Zeit die Bildung jedes einzelnen der Milliarden von Schneekristallen, ebenso notwendig ist die Anhäufung der Flocken, ebenso notwendig der Weg jeder Flocke von der Schneewolke bis zur Erdoberfläche. Dichtigkeit und Wärme der Luftschichten, der Wind und möglicherweise noch andre Energien bestimmen den Weg. Jede Schneeflocke muß zuletzt auf den Zweig niedersinken, auf dem sie liegen bleibt." [10]
Der Niederländer Gerard 't Hooft fasst die Definition von einem Kollegen zusammen:
ZITAT:
"Determinismus bedeutet, dass man jedes beliebige Modell konstruieren kann, in dem klassische Gleichungen das Verhalten dynamischer Variablen bestimmen und in dem die Evolutionsgesetze auf den kleinsten Skalen, auf denen diese Variablen die Daten beschreiben, keinerlei Unklarheiten zulassen. Es gibt keine Wellenfunktionen, keine statistischen Betrachtungen, da alles Geschehen durch Gewissheiten kontrolliert wird. Darüber hinaus herrscht ein gewisses Maß an Lokalität: Die Gesetze steuern alle Prozesse ausschließlich anhand der Daten, die an bestimmten Orten vorliegen, während Fernwirkungen oder zeitliche Rückwirkungen ausgeschlossen sind." [15]
"Determinismus bedeutet, dass man jedes beliebige Modell konstruieren kann, in dem klassische Gleichungen das Verhalten dynamischer Variablen bestimmen und in dem die Evolutionsgesetze auf den kleinsten Skalen, auf denen diese Variablen die Daten beschreiben, keinerlei Unklarheiten zulassen. Es gibt keine Wellenfunktionen, keine statistischen Betrachtungen, da alles Geschehen durch Gewissheiten kontrolliert wird. Darüber hinaus herrscht ein gewisses Maß an Lokalität: Die Gesetze steuern alle Prozesse ausschließlich anhand der Daten, die an bestimmten Orten vorliegen, während Fernwirkungen oder zeitliche Rückwirkungen ausgeschlossen sind." [15]
Je mehr den Physikern das auch gelingt, desto eher neigen manche Denker den Erfolg zu verallgemeinern und zu denken dass die ganze Welt vorhersagbar ist. Das entsprechende Denkprinzip ist die sogenannte Kausalität. Die Kausalität war ein Grundpfeiler für die 👉 klassische Physik [bis etwa 1900]
Doch diese Vorstellung einer vollständigen Vorhersagbarkeit der Welt, Ziel einer deterministisch angelegten Physik, bringt Probleme mit dem Freien Willen mit sich. Der Physiker Stephen Hawking etwa erwog den Gedanken, ob in einer determinierten Welt Gott noch die Möglichkeit habe, seinen Willen zu ändern (change his mind). [13]
Determinismus in der Quantenphysik
Der Determinismus der klassischen Physik setzt voraus, dass man a) einen momentanen Zustand eines Systems beliebig genau messen und b) dass daraus immer eindeutig ein Folgezustand entsteht. Beide Voraussetzungen sind in der Quantenphysik (ab etwa 1920) nicht mehr gegeben.
ZITAT:
"Von Philosophen wurde die Behauptung aufgestellt, daß, wenn die gleichen Umstände nicht immer zu den gleichen Resultaten führen, Vorhersagen unmöglich sind, was das Ende der Naturwissenschaften bedeuten müßte." Richtet man zum Beispiel ein Photon in immer derselben Richtung auf dieselbe Glasscheibe müsste das Photon auch immer am selben Zielort A oder B ankommen. Feynman weiter: "Wir können nicht vorhersagen, ob ein bestimmtes Photon in A oder B anlangen wird. Wir können einzig voraussagen, daß von 100 Photonen, die auf dem Glas landen, durchschnittlich 4 an der Oberfläche reflektiert werden. Heißt das nun, daß die Physik, eine Wissenschaft mit großer Genauigkeit, sich damit zufriedengeben muß, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses zu berechnen, und außerstande ist, genau vorherzusagen, was passieren wird? Ja, das heißt es." [11]
"Von Philosophen wurde die Behauptung aufgestellt, daß, wenn die gleichen Umstände nicht immer zu den gleichen Resultaten führen, Vorhersagen unmöglich sind, was das Ende der Naturwissenschaften bedeuten müßte." Richtet man zum Beispiel ein Photon in immer derselben Richtung auf dieselbe Glasscheibe müsste das Photon auch immer am selben Zielort A oder B ankommen. Feynman weiter: "Wir können nicht vorhersagen, ob ein bestimmtes Photon in A oder B anlangen wird. Wir können einzig voraussagen, daß von 100 Photonen, die auf dem Glas landen, durchschnittlich 4 an der Oberfläche reflektiert werden. Heißt das nun, daß die Physik, eine Wissenschaft mit großer Genauigkeit, sich damit zufriedengeben muß, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses zu berechnen, und außerstande ist, genau vorherzusagen, was passieren wird? Ja, das heißt es." [11]
Die genaue Messbarkeit wird unter anderem durch die Heisenbergsche Unschärferelation sowie auch den unausweichlichen Einfluss der messenden Person auf das Messergebnis (Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon, Verschränkuung) zunicht gemacht. Und dass aus einem Zustand A immer eindeutig genau ein Zustand B folgt, also die Kernidee einer strengen Kausalität, wurde durch den stochastischen Charakter aller quantenphysikalischen Gesetze abgelöst [7]. Siehe mehr zu den grundlegenden Wesenszügen dieser neuartigen Physik im Artikel zur 👉 Quantenphilosophie
Der Laplace-Dämon als deterministischer Quälgeist
Der Laplacesche Dämon ist eine berühmte Metapher für ein deterministisches Weltbild [3] im Sinne der klassischen Physik. Erdacht wurde er von dem Mathematiker und Zeitgenossen Goethes, Pierre-Simon Laplace (1749 bis 1827). Der Dämon kann mit Hilfe der Naturgesetze alle Zustände der Welt aus der Vergangenheit bis in die fernste Zukunft berechnen. Mehr dazu unter 👉 Laplacescher Dämon
Determinismus als Weltanschauung und Lebenshaltung
Als düstere, dystopische Welttheorie kam der Determinismus spätestens im 18ten Jahrhundert auf. Im 19ten Jahrhundert gewann er zunehmend viele Anhänger. In der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts war er sehr verbreitet. Literarisch verarbeitet hat das unter anderem der amerikanische Schriftsteller 👉 H. P. Lovecraft (Zitate)
Zur Aktualität des Determinismus
Viele Menschen lehnen (und lehnten) den Determinismus instinktiv ab. Als Hauptargument gilt ihnen die unmittelbare Erfahrung eines Freien Willens. Seit dem Aufkommen der statistischen Quantenphysik in den 1920er Jahren gelten auch die modernen physikalischen Naturgesetze nicht mehr als zwingender Beweis eines physikalischen Determinismus. [12] Das Thema gehört zu den großen (ungelösten) Forschungsfragen. Ein starkes physikalisches Argument gegen einen Determinismus ist die möglicherweise untrennbare Verknüpfung von unserem psychischen [3] Erleben mit physiaklischen Effekten. Ein nicht-deterministisches Weltbild auf Grundlage (quanten)physikalischer Phänomene entwickelte der US-amerikanische Physiker Johan Archibald Wheeler (1911 bis 2008) unter dem Stichwort 👉 partizipatorisches Universum
Fußnoten
- [1] Drews Friedemann: Menschliche Willensfreiheit und göttliche Vorsehung bei Augustinus, Proklos, Apuleius und John Milton. De Gruyter. 2009. ISBN: 978-3110330076. Dort das Kapitel: Allwissen statt Vorherwissen als Grundlage für Augustins Begriff der Prädestination? oder: Weshalb das überzeitliche Bestimmtsein in Gottes Erkennen keinen geschichtlichen Determinismus erzeugt.
- [2] S. Müller: Logik der Freiheit. Die Prädestinationslehre Wilhelms von Ockham im Rahmen seiner Theologie. Archa Verbi, [s. l.], v. 17, p. 194–197, 2020. Siehe auch 👉 Prädestinationslehre
- [3] Deutsch in: Oskar Höfling: Physik. Band II Teil 1, Mechanik, Wärme. 15. Auflage. Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn 1994, ISBN 3-427-41145-1. Französische Originalquelle: Essai philosophique sur les probabilites aus dem Jahr 1814.
- [4] Roger Penrose: Computerdenken. Die Debatte um künstliche Intelligenz, Bewusstsein und die Gesetze der Physik. Springer Verlag. 1989. Siehe auch 👉 Computerdenken
- [5] John Archibald Wheeler: Information, physics, quantum: The search for links. In: Zurek, Wojciech Hubert (ed.). Complexity, Entropy, and the Physics of Information. 1990. Redwood City, California: Addison-Wesley. ISBN 978-0-201-51509-1. (Definition von "participatory universe" auf Seite 5). Siehe auch 👉 partizipatorisches Universum
- [6] Joachim von Bublath: Chaos im Universum. Droemersche Verlagsanstalt. München. 2001. Dort die Seite 117. ISBN: 3-426-27193-1. Siehe auch 👉 Chaostheorie
- [7] Der Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger (1887 bis 1961) sieht die Abläufe in der Welt als determiniert an. In der Quantenphysik sind die Abläufe aber nur noch statistisch (stochastisch) determiniert: "Nach dem oben Vorgebrachten sind die raumzeitlichen Abläufe im Körper eines Lebewesens, die seiner Geistestätigkeit und seinen bewußt oder sonstwie ausgeführten Handlungen entsprechen, wenn nicht strikt deterministischer, so doch statistisch-deterministischer Art (auch in Anbetracht ihrer komplexen Struktur und der allgemein anerkannten Deutung der physikalischen Chemie)." In: Erwin Schrödinger: Was ist Leben?: Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. R. Piper GmbH & Co. KG, München 1987. ISBN: 3-492-11134-3. Dort im Epilog das Kapitel "Determinismus und Willensfreiheit" auf Seite 121. Siehe auch 👉 Freier Wille
- [8] "The test of all knowledge is experiment. Experiment is the sole judge of scientific 'truth'." In: Feynman, R.P.; R.B. Leighton and M. Sands, 1963. The Feynman Lectures on Physics, Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company. Page 1-1.
- [9] Determinismus in den Worten von Niels Bohr, am Beispiel der Newtonschen Himmelsmechanik: "The description thus achieved was a so-called deterministic description. This means that it proved possible, from a knowledge of the state of a physical system as defined by the positions and motions of its parts, together with a knowledge of the forces between these parts, to calculate or predict the state of the system at any later time. This great achievement, the foremost expression of which was Newton's explanation of Kepler's laws governing the motions of the planets around the sun and of the satellites around the planets, made an overwhelming impression at the time. This kind of description, therefore, came to stand as the ideal for scientific explanation." In: Niels Bohr: Atoms and Human Knowledge. Vorlesung vom 13. Dezember 1957. Universität von Oklahoma. USA. Online: http://www.nhn.ou.edu/assets/doc-or-pdf/Bohr-1957-large.pdf
- [10] Das Zitat zur Schneeflocke stammt aus einer längeren Betrachtung zum Fatalismus des Philosophen Fritz Mauthner (1849 bis 1923) stammt aus dem Artikel "Fatalismus". In: Mauthner, Fritz: Wörterbuch der Philosophie. Leipzig 1923, Band 1, S. 462-468. Online: http://www.zeno.org/nid/20006180523
- [11] Das Zitat zur Preisgabe der Kausalität in der Quantenphysik am Beispiel der Reflexion von Licht an Glas stammt von: Richard Feynman: QED: Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie. Piper Verlag. 1. Auflage 1992. ISBN: 3-492-21562-9. Dort die Seite 30. Siehe auch 👉 QED (Feynman)
- [12] Um 1927 wird der Determinismus angezweifelt, vielleicht ist er nur eine Denkneigung: "The cast-iron determinism ofprimary law is, I think, still widely accepted but no longer unquestioningly. It now seems clear that we have not yet got hold of any primary law—that all those laws at one time supposed to be primary are in reality statistical. No doubt it will be said that that was only to be expected; we must beprepared for a very long search before we get down to ultimate foundations, and not be disappointed if new discoveries reveal unsuspected depths beneath. But I think it might be said that Nature hasbeen caught using rather unfair dodges to prevent our discovering primary law—that kind of artfulness which frustrated our efforts to discover velocity relative to the aether. I believe that Nature is honest at heart, and that she only resorts to these apparent shifts of concealment when we are looking for something which is not there. It is difficult to see now any justification for the strongly rooted conviction in the ultimate re-establishment of a deterministic scheme of law, except a supposed necessity of thought. Thought has grown accustomed to doing without a great many 'necessities' in recent years." In der darauffolgenden Zeile erwähnt Stanley die Quantenphysik. In: Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort im Kapitel "Becoming", Seite 98.
- [13] Der Physiker Stephen Hawking diskutiert kurz die Freiheit Gottes als ein Argument dafür, dass die Naturgesetze nicht alles abschließend regeln. Hawking stellt zunächst drei Möglichkeiten für die Existenz einer Theory of Everything (TOE) vor: a) es gibt eine solche Theorie und eines Tages werden wir sie entdecken, b) es gibt keine komplett vereinheitliche Theorie, nur eine unendliche Abfolge (ininites sequence) von Theorien, und c) es gibt gar keine Theorie des Universums (theory of the universe). Die Ereignisse passieren zufällig (random) und willkürlich (arbitrary). Hawking verweist dann darauf, dass für die dritte Möglichkeit argumentieren, da Gott nur in einer solchen Welt die Freiheit hätte, seinen Willen (freedom to change his mind) hätte. Doch Hawking geht einen Schritt weiter, bezieht sich auf den Kirchenvater Augustinus aus der spätrömischen Antike: da Gott außerhalb der Zeit existiere, kann kein Widerspruch auftreten. Vermutlich habe Gott es nicht nötig, den Ablauf der Welt noch zu ändern, nachdem er sie einmal in Gang gesetzt hatte. Hawkings dazu etwas salopp: "He knew what he intended when He set it up", auf Deutsch: Gott wusste schon was er wollte, als er die Welt in Gang gesetzt hatte. In: Stephen Hawking: The Origin and Fate of the Universe by Stephen W. Hawking. Phoenix Books, 2006. Dort im Kapitel "The Theory of Everything", Seite 161. Siehe mehr unter 👉 TOE
- [14] Gerard 't Hooft: "[John Stewart] Bell assumed that determinism means that one can build a model, any model, in which classical equations control the behaviour of dynamical variables, and where, at the tiniest scales where these variables describe the data, the evolution laws do not leave the slightest ambiguity; there are no wave functions, no statistical considerations, as everything that happens is controlled by certainties. Moreover, there is some sense of locality: the laws control all processes using only the data that are situated at given localities, while action at a distance, or backwards in time, are forbidden." In: In: Gerard t'Hooft: Time, the arrow of time, and Quantum Mechanics. 2018. Online: https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.01383