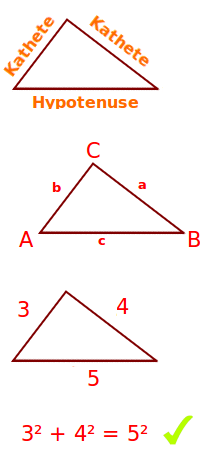Satz des Pythagoras
a² + b² = c²
© 2016
- 2026
Basiswissen|
Einführung zum Satz des Pythagoras|
Formel für den Satz des Pythagoras|
Legende|
Was sind die Katheten (a und b) und was die Hypotenuse (c)?|
Der Satz des Pythagoras rein rechnerisch|
Der Satz des Pythagoras geometrisch gedeutet|
Der praktische Nutzen|
Die längste Seite berechnen (Hypotenuse)|
Eine der zwei kürzeren Seiten berechnen (Kathete)|
Gilt der Satz des Pythagoras immer?|
Kann man den Satz beweisen?|
Exkurs I: der Satz des Pythagoras als Wahrsagerei|
Exkurs II: der Satz des Pythagoras und gekrümmte Räume|
Aufgaben (mit Lösungen)|
Weitere Aufgaben zum Satz des Pythagoras|
Persönliche Anmerkung|
Fußnoten
Basiswissen
a² + b² = c² ist der Satz des Pythagoras kurz als Formel [3] geschrieben: man hat ein rechtwinkliges Dreieck mit drei Seiten: a, b und c. Das kleine c steht dabei für die längste Seite, die Hypotenuse. Der Satz besagt, dass die längste Seite zum Quadrat gerechnet immer dasselbe Ergebnis gibt wie die Summe aus den Quadraten der beiden kürzeren Seiten. Mit diesem Wissen kann man dann in jedem rechtwinkligen Dreieck die noch unbekannte Länge einer Seite berechnen, wenn man die Längen der zwei anderen Seiten kennt. Das ist hier näher erklärt.
Einführung zum Satz des Pythagoras
Der Satz des Pythagoras gilt nur für rechtwinklige Dreiecke (genau ein 90°-Winkel) und alle rechtwinkligen Dreiecke. Er besagt: multipliziert man die Längen der beiden kürzeren Seiten (Katheten) mit sich selbst und addiert diese Zwischenergebnisse zusammen, erhält man immer dasselbe Ergebnis wie bei der Multiplikation der längsten Seite (Hypotenuse) mit sich selbst. Mit Hilfe dieser Formel genügt es, bei einem rechtwinkligen Dreieck die Länge von zwei Seiten zu kennen. Man kann dann die Länge der dritten Seite immer berechnen.
Formel für den Satz des Pythagoras
- a² + b² = c²
Legende
- a = Länge von einer 👉 Kathete
- b = Länge der anderen 👉 Kathete
- c = Länge der 👉 Hypotenuse
Was sind die Katheten (a und b) und was die Hypotenuse (c)?
- a² meint dasselbe wie a mal a.
- Der Satz des Pythagoras gilt nur für ein 👉 rechtwinkliges Dreieck
- Der Satz des Pythagoras gilt für alle rechtwinkligen Dreiecke.
- In einem rechtwinkligen Dreieck gibt es immer eine 👉 Hypotenuse
- Die Hypotenuse liegt immer gegenüber vom rechten 👉 Winkel
- Die Hypotenuse ist immer die längste Seite im Dreieck.
- Das c in der Formel steht immer für die Länge der Hypotenuse.
- Die beiden anderen Seiten heißen 👉 Katheten
- Die Katheten sind die Schenkel des rechten Winkels.
- Die Katheten sind immer die zwei kürzeren Seiten.
- Das a ist die Länge von einer der beiden Katheten.
- Das b ist die Länge der anderen der beiden Katheten.
Der Satz des Pythagoras rein rechnerisch
- Man nimmt die Länge einer Kathete mit sich selbst mal.
- Mit sich selbst malnehmen nennt auch hoch zwei rechnen oder 👉 quadrieren
- Man nimmt die Länge der anderen Kathete mit sich selbst mal.
- Man addiert diese beiden Ergebnisse.
- Wenn man die Länge der Hypotenuse mit sich selbst malnimmt, …
- kommt dabei immer dieselbe Zahl heraus.
Der Satz des Pythagoras geometrisch gedeutet
- Man nimmt eine der zwei Katheten.
- Man nennt diese Seite und ihre Länge a.
- Man betrachtet sie als eine von vier Seiten von einem 👉 Quadrat
- Man zeichnet dann damit ein Quadrat, das ist das Quadrat „über der ersten Kathete“.
- Man macht dasselbe dann mit der zweiten Kathete und mit der Hypotenuse.
- Die zweite Kathete und ihre Länge nennt man b, die Hypotenuse nennt man c.
- Man hat dann also insgesamt drei Quadrate gezeichnet.
- Man berechnet dann für jedes Quadrat einzeln die 👉 Quadratfläche
- a mal a oder kurz a² gibt den Inhalt des ersten Quadrates.
- b mal b oder kurz b² gibt den Inhalt des zweiten Quadrates.
- c mal c oder kurz c² gibt den Inhalt des dritten Quadrates.
- Dann addiert man die ersten beiden Flächen.
- Diese Summe gibt genau die Fläche des dritten Quadrates.
- Man sagt: die Summe der Quadrate über den zwei Katheten, …
- ist vom Zahlenwert her gleich dem Quadrat über der Hypotenuse.
Der praktische Nutzen
Der Satz des Pythagoras war spätesten seit 1500 v. Chr. den Babylonieren [4], seit vielleicht 500 v Chr. den Indern und seit spätestens 100 v. Chr den Chinesen bekannt. Der große praktische Nutzen besteht darin, dass man nur zwei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks kennen muss. Die dritte fehlende Seite kann man dann berechnen. Das eröffnet die Möglichkeit, die Länge von Diagonalen, etwa als Stütztbalken in einem Raum oder auch die Breite von Seen zu berechnen, ohne dass man dabei die gesuchten Strecken selbst abschreiten muss.
Die längste Seite berechnen (Hypotenuse)
- Bekannt sind: a und b
- Z. B. a=5 und b=12
- Man geht aus von: a²+b² = c²
- c ist die Länge der gesuchten Hypotenuse.
- Man formt die Gleichung um nach c:
- a²+b² = c² | auf beiden Seiten die Wurzel ziehen
- Wurzel von (a²+b²) = c
- Einsetzen: Wurzel von (5²+12²) = 13
- Die gesuchte Länge von c ist: 13
- Mehr dazu unter Hypotenuse über Pythagoras => 👉 pdf
Eine der zwei kürzeren Seiten berechnen (Kathete)
- Man geht aus von: a²+b² = c²
- c ist die Hyptonuse, also die längste Seite.
- a ist eine der zwei Katheten, b die andere.
- Es ist für a und b egal, wer die längere ist.
- Man formt um nach zum Beispiel a:
- a² + b² = c² | -b²
- a² = c²-b² | Wurzel ziehen
- a = Wurzel aus (c²-b²)
- Zahlenbeispiel: c=5 und b=4. Wie lang ist a?
- Einsetzen: a = Wurzel aus (5²-4²)
- a = Wurzel aus (25-16) = 3
- Die gesuchte Kathete hat die Länge 3.
- Mehr dazu unter 👉 Kathete über Pythagoras
Gilt der Satz des Pythagoras immer?
Solange man rechtwinklige Dreiecke auf flachen, ungekrümmten Flächen zeichnet, etwa auf einem glatten Stück Papier auf einem Tisch, dann stimmt der Satz immer. Interessant ist jetzt ein Gedankenexperiment, bei dem der Satz zunehmend nicht mehr stimmt. Man stellt sich die Erde als völlig perfekte Kugel vor. Wir leben dann gedanklich auf dieser Kugeloberfläche. Nun zeichnen wir ein kleines rechtwinkliges Dreieck. Wenn wir die Seitenlängen messen und damit den Satz des Pythagoras überprüfen wird er (abgesehen von kleinen Messungenauigkeiten) immer sehr gut aufgehen, also stimmen. Machen wir das Dreieck aber gedanklich sehr groß, dann geht die Gleichung immer schlechter auf. Der Grund ist dass war nicht auf einer glatten ebenen Fläche zeichnen, sondern auf einer gekrümmten Kugeloberfläche [1]. Tatsächlich gibt es ein großes Gebiet der Geometrie, das sich mit Figuren auf Kugeloberflächen beschäftigt. Das ist die sogenannte sphärische Geometrie. Ein sehr interessanter Fall zu diesem Gedanken ist das von uns so genannte 👉 Galapagos-Dreieck
Kann man den Satz beweisen?
Ja, im Jahr 2024 gelang es Schülern aus den USA sogar, insgesamt 5 neue Beweise vorzulegen. Die Beweise wurden in einem wissenschaftlichen Artikel auf Englisch veröffentlich. [2]
Exkurs I: der Satz des Pythagoras als Wahrsagerei
Der Satz des Pythagoras ist recht einfach zu verstehen und anzuwenden. An ihm zeigt sich aber gleichzeitig auch eine sehr tiefgründige und begehrte Eigenschaft vieler (natur)wissenschaftlicher oder mathematischer Erkenntnisse: man kann damit etwas aus der Zukunft voraussagen. Das ist zunächst nicht offensichtlich. Man kann den Satz aber etwas umformulieren, und dann wird es deutlich:
MERKSATZ:
Wenn man die Längen von zwei kurzen Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck misst, kann man nach einer einfachen Rechnung mit großer Genauigkeit vorhersagen, was das Messergebnis sein wird, wenn man die Länge der längsten Seite misst.
Wenn man die Längen von zwei kurzen Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck misst, kann man nach einer einfachen Rechnung mit großer Genauigkeit vorhersagen, was das Messergebnis sein wird, wenn man die Länge der längsten Seite misst.
Damit kann man zumindest für einen Aspekt in die Zukunft blicken. Man sieht nicht die ganze Zukunft, aber einen Teil davon kann man genau voraussagen. Das heißt umgekehrt aber auch, dass die Zukunft, also die Entwicklung der Welt, sich wahrscheinlich an den Satz des Pythagoras "halten wird", sie wird ihn nicht verletzten. Damit wird die Zukunft für Menschen zumindest etwas voraussehbarer, planbarer, weniger chaotisch. Die Idee, dass die Welt bewusst so eingerichtet ist, dass wir als Menschen in ihr gewisse Regeln erkennen können, um unsere eigene Zukunft auch gestalteten zu können, bezeichnet man in der Philosophie auch als 👉 Intelligibilität
Exkurs II: der Satz des Pythagoras und gekrümmte Räume
Der Satz des Pythagoras gilt für alle rechtwinkligen Dreiecke auf einer ebenen, perfekt flachen Fläche, etwa einem perfekt flachen Tisch. Er gilt aber nicht für sehr große rechtwinklige Dreiecke: die Stadt Mogadischu liegt an der Ostküste Afrikas, nahe am Äquator. Man stelle sich jetzt einen Piloten vor, der in einer geraden Linie von Mogadischu aus zum Nordpol fliegt und dabei exakt die geflogene Strecke misst. Ein anderer Pilot fliegt von Mogadischu aus parallel zum Äquator nach Osten, bis zum Stadtstaat Singapur in Südostasien. Auch dieser Pilot habe die Strecke gemessen. Die zwei Flugstrecken treffen in Mogadischu in einem Winkel von genau 90° aufeinander. Nun fliege ein dritter Pilot in direkter gerader Linie vom Nordpol nach Singapur. Auch dieser Pilot soll wieder die Strecke messen. Diese Strecke ist dann die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks. Hier sind die drei gemessenen Entfernungen:
- 1. Kathete: Mogadischu-Nordpol: 9781 km
- 2. Kathete: Mogadischu-Singapur: 6503 km
- Hypotenuse: Nordpol-Singapur: 9864 km
Wendet man den Satz des Pythgaroras an, kommt man auf folgende Gleichung: 9781²+6503²=9864². Ausgerechnet gibt das die (ziemlich falsche) Aussage: 137956970 = 97298496. In Worten müssten dann etwa 137 Millionen gleich 97 Millionen sein. Die Abweichung ist viel zu groß, als dass sie durch kleine Messfehler oder ein nur geringfügige Abweichung von der Rechtwinkligkeit des Dreiecks herrührt. Tatsächlic ist der Grund für die große Abweichung, dass das Dreieck nicht in einer flachen Ebene sondern auf einer Kugel gedacht werden muss. Und für Dreiecke auf Kugelflächen gilt der Pythagoras in der einfachen Form a²+b²=c² nicht mehr. Man hat jetzt eine gekrümmte Fläche und benötigt die sogenannte sphärische Geometrie.
Auf einer gekrümmten Fläche, etwa der Erdoberfläche, gilt "der Pythagoras" also nicht mehr. Der folgende Gedanke führt jetzt zur Idee eines gekrümmten Raumes. Angenommen, man würde im Weltraum mit Hilfe von Laserlichtern ein riesiges Dreieck aufspannen. Drei Raumschiffe bilden die Ecken. Die Raumschiffe könnten sich so lange zueinander bewegen, bis ein perfekt rechtwinkliges Dreieck entsteht. Und wenn Licht sich geradlinig ausbreitet [8], dann sind die Strecken zwischen den Ecken des Dreiecks gerade Linien. Wenn aber auch hier der Satz des Pythagoras trotz sorgfältigster Messung nicht passen sollte, welchen Schluss soll man das ziehen? Stimmt etwas mit dem Raum an sich nicht? Genau diese Frage führt zur Idee, dass auch der Raum vielleicht nicht "flach" sondern "gekrümmt" ist, in Analogie zu einer gekrümmten Fläche. Siehe dazu den Artikel 👉 gekrümmter Raum
Aufgaben (mit Lösungen)
a) a = 3, b = 4: berechne c.
b) a = 5, b = 12: berechne c.
c) a = 7, b = 24: berechne c.
d) c = 10, a = 6: berechne b.
e) c = 13, a = 5: berechne b.
f) c = 17, b = 8: berechne a.
g) a = 9, b = 40: berechne c.
h) c = 25, b = 15: berechne a.
i) a = 11, b = 60: berechne c.
j) c = 65, a = 16: berechne b.
k) Ein Dreieck hat Kathetenlängen 8 cm und 15 cm. Wie lang ist die Hypotenuse?
l) Eine Hypotenuse misst 26 m, eine Kathete 10 m. Welche Länge hat die andere Kathete?
m) Ein Leiter lehnt an einer Wand: die Länge der Leiter (Hypotenuse) ist 5 m, der Fuß steht 3 m von der Wand entfernt. Wie hoch reicht die Leiter an der Wand?
n) In einem rechtwinkligen Grundstücksdreieck ist eine Kathete 20 m lang, die Hypotenuse 29 m. Berechne die Länge der anderen Kathete.
o) Du willst eine diagonale Diagonale (Hypotenuse) eines rechteckigen Plots mit den Seiten 14 m und 48 m berechnen. Wie lang ist sie?
p) Ein rechteckiger Bildschirm hat eine Breite von 24 cm und Diagonale von 30 cm. Wie hoch ist der Bildschirm?
q) Eine Rolltreppe bildet ein rechtwinkliges Dreieck mit der Bodenfläche: die Länge der Rolltreppe ist 13 m, die horizontale Projektion ist 5 m. Wie hoch ist die vertikale Höhe?
r) In einem Dreieck beträgt eine Kathete 12 m und die Hypotenuse 20 m. Ermittele die Länge der anderen Kathete.
s) Ein rechtwinkliges Dreieck hat Seitenlängen 3, x, 5. Berechne x.
t) Eine Segelmaststütze bildet ein rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse 17 m und einer Kathete 15 m. Wie lang ist die andere Kathete?
u) Ein Rechteck hat Seiten 10 m und 24 m. Wie lang ist die Diagonale?
v) In einem rechtwinkligen Dreieck ist eine Kathete 21 m, die Hypotenuse 29 m. Berechne die andere Kathete.
w) Du misst eine Diagonale eines rechteckigen Tisches. Die Breite beträgt 18 cm, die Diagonale 30 cm. Wie tief ist der Tisch?
x) Eine Leiter steht 12 m von der Hauswand. Die Leiter ist 13 m lang. Wie hoch erreicht sie an der Wand?
y) Ein Dachsparren bildet im Querschnitt ein rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse 20 m und Fuß = 12 m. Wie hoch ist das Dach auf dieser Seite?
z) Bei einer rechteckigen Fläche von 45 m Länge und 28 m Breite berechne die Diagonale.
Lösungen: a) 5 | b) 13 | c) 25 | d) 8 | e) 12 | f) 15 | g) 41 | h) 20 | i) 61 | j) 63 | k) 17 | l) 24 | m) 4 | n) 21 | o) 50 | p) 18 | q) 12 | r) 16 | s) 4 | t) 8 | u) 26 | v) 20 | w) 24 | x) 5 | y) 16
Weitere Aufgaben zum Satz des Pythagoras
- => qck [gemischte Aufgaben]
Persönliche Anmerkung
 Ein Reiz des Satzes des Pythagoras ist seine Schlichtheit: a²+b²=c² ist leicht eingängig und mathematisch nicht sonderlich schwierig. Und dennoch kann man mit diesem schlichten Lehrsatz eine Fülle von Dingen aus der Wirklich berechnen und erklären. Der Satz ist mächtig in seinen Anwendungen. Das Thema dürfte minimalistisch veranlagten Denkern gefallen: man lernt eine kleine Sache auswendig. Ab dann ist der Rest nur noch Denken. Das ist nicht mit allen Themen so. Die quadratischen Funktionen sind nahezu das Gegenteil: dort überfluten die meisten Schul- und Lehrbücher Neulinge direkt schon auf den ersten Seiten mit einer Überfülle neuer Worte und Rechenwege. Zumindest am Anfang hat man zunächst keine Chance, die inneren logischen Verbindungen zu erkennen. Die Lernkurve ist flach. Freunde des minimalistischen Denkens können über den Satz des Pythagoras in noch zwei weitere tiefgründige Gebiete der Mathematik einsteigen: über den Fermatschen Satz kommt man in die Abgründe der sogenannten Zahlentheorie. Und der Versuch den Satz des Pythagoras auf große Dreiecke auf der Oberfläche der Erde anzuwenden führt in die - für mich - geheimnisumwitterten Welten der sphärischen Geometrie und gekrümmter Räume.
Ein Reiz des Satzes des Pythagoras ist seine Schlichtheit: a²+b²=c² ist leicht eingängig und mathematisch nicht sonderlich schwierig. Und dennoch kann man mit diesem schlichten Lehrsatz eine Fülle von Dingen aus der Wirklich berechnen und erklären. Der Satz ist mächtig in seinen Anwendungen. Das Thema dürfte minimalistisch veranlagten Denkern gefallen: man lernt eine kleine Sache auswendig. Ab dann ist der Rest nur noch Denken. Das ist nicht mit allen Themen so. Die quadratischen Funktionen sind nahezu das Gegenteil: dort überfluten die meisten Schul- und Lehrbücher Neulinge direkt schon auf den ersten Seiten mit einer Überfülle neuer Worte und Rechenwege. Zumindest am Anfang hat man zunächst keine Chance, die inneren logischen Verbindungen zu erkennen. Die Lernkurve ist flach. Freunde des minimalistischen Denkens können über den Satz des Pythagoras in noch zwei weitere tiefgründige Gebiete der Mathematik einsteigen: über den Fermatschen Satz kommt man in die Abgründe der sogenannten Zahlentheorie. Und der Versuch den Satz des Pythagoras auf große Dreiecke auf der Oberfläche der Erde anzuwenden führt in die - für mich - geheimnisumwitterten Welten der sphärischen Geometrie und gekrümmter Räume.Fußnoten
- [1] Bei Gesetzen spricht man von einem sogenannten Gültigkeitsbereich. Das ist der Bereich der Wirklichkeit für den ein Gesetz ausreichend gut passt. In der Mathematik entspricht dieser Gedanke dem Definitionsbereich.
- [2] Bis zum Jahr 2024 gab es lediglich zwei anerkannte Beweise des Satzes des Pythgaros. Schüler in den USA fügten dem im Jahr 2024 insgesamt 5 neue und eigenständige Beweise hinzu. Die Ergebnisse wurden in einer Fachzeitschrift auf Englisch veröffentlicht. Jackson, N., & Johnson, C.: Five or Ten New Proofs of the Pythagorean Theorem. The American Mathematical Monthly, 131(9), 739–752. (2024). Online: https://doi.org/10.1080/00029890.2024.2370240
- [3] 1906, der Satz des Pythagoras als Beispiel für eine Formel: "Formel (lat. formula), für besondere Fälle entweder ausdrücklich vorgeschriebene oder durch den Gebrauch eingeführte Worte, Redensarten oder Wendungen, z. B. Gebets-, Rechtsformeln. In der Mathematik versteht man unter F. die Darstellung von Größen und Sätzen durch die Zeichensprache der Mathematik, z. B. ist (a + b) die F. für die Summe der beiden Größen a und b; a² + b² = c³ die F. für den pythagoreischen Lehrsatz etc. Über Chemische Formeln s.d." In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 6. Leipzig 1906, S. 768. Online: http://www.zeno.org/nid/20006624812
- [4] Im antiken Babylon war der Satz seit etwa 1500 vor Christus bekannt: In: Helmuth Gericke: Mathematik in Antike und Orient. Berlin 1984, S. 33 f.
- [5] Die Inder listeten um 600 vor Christus schon verschiedene pythagoräische Tripel auf und nutzen den Satz in seiner allgemeinen Bedeutung. In: Helmuth Gericke: Mathematik in Antike und Orient. Berlin u. a. 1984, S. 66–69.
- [6] Jean-Claude Martzloff: A History of Chinese Mathematics. Berlin u. a. 1997, S. 124, 126.
- [7] Zum Beispiel Landvermesser, Markscheider und Geographen benötigen die sphärische Geometrie. Sie ist mathematisch deutlich schwieriger als die Geometrie flacher Ebenen. Siehe mehr unter 👉 sphärische Geometrie
- [8] Dass Licht sich geradlinig ausbreitet, stimmt nicht ganz: es wird etwas durch Masse abgelenkt. Das ist eine Folgerung aus Einsteins allgemeiner 👉 Relativitätstheorie