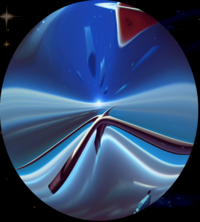Gekrümmter Raum
Physik
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Ziel der Erklärung hier|
Innere und äußere Krümmung|
Ausgangspunkt: unser Raum ist dreidimensional|
An Anfang: niedrigdimensionale Räume|
Extrapolation zu höherdimensionalen Räumen|
Zwischengedanke: die Trennung von Räumen|
Mehrfach zusammenhängende Gebilde|
Verlust der Lichtintensität als Indiz der Dimensionalität|
Raumkrümmung|
Das Krümmungsmaß für Linien|
Das Krümmungsmaß für Flächen und Räume|
Der gekrümmte Raum und die Gravitationskraft|
Arthur Stanley Eddington über gekrümmte Raumzeit|
Fußnoten
Basiswissen
Was kann man sich unter einem gekrümmten Raum anschaulich vorstellen? [4] Das Wort Raumkrümmung ist in der Physik üblich aber nicht leicht verständlich. Eine sehr anschauliche Hinführung zur Idee eines gekrümmten Raumes stammt von dem Physiker Franz Serafin Exner. Dessen Gedankengang ist hier kurz vorgestellt.
Ziel der Erklärung hier
Franz Exner war ein herausragender Physiker seiner Zeit. 1919 wurden seine Vorlesungen in Buchform veröffentlicht. Exner hatte eine Gabe, auch sehr abstrakte Sachverhalte in anschaulicher Form zu erklären. Sehr ausführlich erklärt er, wie man überhaupt zu der Idee eines gekrümmten Raumes kam. Das ist hier kurz wiedergegeben.
Innere und äußere Krümmung
Man unterscheidet heute eine innere und eine äußere Krümmung von geometrischen Gebilden. Bei einer äußeren Krümmung stellt man sich ein geometrisches Objekt eingebettet in eine höhere Dimension vor [8]: eine Linie in einer Ebene, eine Ebene in einen Raum und ein Raum in etwas Vierdimensionales. Bei einer nur äußeren Krümmung kann man die Krümmung nur von außen wahrnehmen, nicht aber von innen: die Innenwinkelsumme von Dreiecken zum Beispiel wäre immer 180°. Die innere Krümmung hingegen kann auch ohne Einbettung in eine höhere Dimension vorgestellt werden. Dreiecke können hier Innenwinkelsummen von mehr (auf Kugeloberflächen) oder auch weniger (auf Rotationsparaboloid) als 180° haben. Der springende Punkt ist dann, dass man eine Krümmung von dem Objekt aus von Innen überprüfen kann. Exner verwendete beide Konzepte, benannte sie aber nicht ausdrücklich.
Ausgangspunkt: unser Raum ist dreidimensional
In seiner 2. Vorlesung [2, Seite 10 bis 17] kritisiert Exner zunächst Kants Vorstellung eines dreidimensionalen Raumes, in dem die bekannten geometrischen Gesetze wie bekannt gelten und zu dem es keine Alternative gibt. Exner legt zuerst dar, wie man überhaupt zu der Idee gelangt, dass unser Raum dreidimensional ist. Ausgangspunkt der Überlegung ist das Bedürfnis, die Lage eines beliebigen Punktes eindeutig beschreiben zu können. Man kann dazu drei flache Ebenen definieren, von denen aber keine zwei Ebenen zueinander parallel sein dürfen. Man kann dann die Lage eines Punktes eindeutig dadurch bestimmen, dass man seinen Abstand zu jeder der drei Ebenen als Zahl angibt. Verzichtet man auf eine der drei Ebenen, kann der Punkt nicht mehr eindeutig verortet werden. Es sind aber auch nicht mehr als drei Ebenen nötig. Damit, so Exner, kann man einen Raum, in dem drei Ebenen zur eindeutigen Verortung eines Punktes nötig aber auch ausreichend sind dreidimensional nennen. Siehe auch 👉 Raum (Physik)
An Anfang: niedrigdimensionale Räume
Für eine dreidimensionalen Raum, so Exner, benötigt man also wie oben erklärt drei Bestimmungsstücke, um den Ort eines Punktes genau festzulegen. Würden nur zwei genügen, dann hätte man einen zweidimesionalen Raum. Man kann das beispielhaft an einer Ebene durchspielen: hier genügen zwei feste Geraden (nicht parallel zueinander), zu denen man jeweils beliebig eine Abstand angeben kann. Über zwei solche unabhängigen Abstände lässt sich jeder Punkt in einer Ebene eindeutig festlegen. Und genügt ein Bestimmstungsstück, so befindet man sich in einem eindimensionalen Raum: eine Linie wäre ein solcher eindimensionaler Raum. Als Bestimmungstück genügt hier ein fester Punkt auf der Linie: gibt man von einem solchen festen Punkt den Abstand an, so ist ein anderer Punkt eindeutig in der Lage festgelegt. Exner versteht hier den Abstand als reelle Zahl, der Abstand kann also auch negativ sein. Das Vorzeichen des Abstandes gibt dann die Richtung an, in die man sich von dem Bestimmungsstück aus bewegt. Mit diesem Gedankengang also kann man jetzt von ein-, zwei- oder auch dreidimensionalen Räumen sprechen.
Extrapolation zu höherdimensionalen Räumen
Nun geht Exner gedanklich in die umgekehrte Richtung, hin zu höheren Dimensionen: wenn es ein-, zwei- und dreidimensionale Räume gibt, könnte es dann nicht auch vier-, fünf- oder sechsdimensionale Räume geben? Exner betont immer wieder, dass hier jede anschauliche Vorstellung versagen muss. Und auch die reale Existenz muss man nicht annehmen. Man kann die Überlegungen als reines Spinnen abstrakter Gedanken auffassen: "Wenn von einem Punke eines Raumes aus eine Bwegung nur in einer einzigen Richtung möglichs ist, so nennen wir diesen Raum eindimensional [Anmerkung: auch eine negative Richtung, wie auf einer Zahlengeraden, ist erlaubt] ; sind zwei aufeinander senkrechte Bewegungsrichtungen möglich und damit auch alle komposanten Bewegungen, so ist der Raum zweidimensional, und dreidimensional im Falle dreier aufeinander senkrechter möglicher Richtungen der Bewegung. Die Analogie lehrt dann, daß wir im vierdimensionalen Raume die Existenz von vier aufeiander senkrechten Koordinaten voraussetzen müssen; ein Fall, der aber ganz außerhalb unseres Vorstellungsvermögens liegt. [1, Seite 12]"
Zwischengedanke: die Trennung von Räumen
Um sich weiter mit der Idee unterschiedlich dimensionaler Räume vertraut zu machen, führt Exner die Idee einer Zerlegung von Räumen ein: ein Raum kann durch ein "trennendes Gebilde" so in zwei Teile zerlegt werden, dass man von einer Seite zur anderen nur gelangen kann, wenn man das trennende Gebilde durchstößt. Bei einem eindimensionalen Raum (Linie) genügt als trennendes Gebilde ein Punkt. Bei einem zweidimensionalen Raum (Ebene) ist das trennende Gebilde eine Linie. Bei einem dreidimensionalen Raum ist das trennende Gebilde eine Ebene. Und extrapoliert man weiter, so ist bei einem vierdimensionalen Raum das trennende Gebilde ein Körper. Vorstellbar ist das freilich nicht, aber rein abstrakt als Spiel der Worte doch zumindest formulierbar.
Mehrfach zusammenhängende Gebilde
Wir haben vorherigen im Abschnitt gesehen, dass ein eindimensionaler Raum (Linie) durch eine Punkt in zwei Teile zerlegt werden kann. Das gilt aber plötzlich nicht mehr, wenn die Linie nicht an ihren beiden Enden verbunden wird, nämlich zu einer geschlossenen Figur, etwa einem Kreis. Dort kann ein Punkt die Linie nicht mehr in zwei Teile teilen. Exner spricht nun an dieser Stelle von einem eindimensionalen Gebilde in einem zweidimensionalen Raum [1, Seite 13]. Die Überlegung funktioniert auch für Flächen, die man etwa zu einem Wulst (Torus) in sich zurückkrümmen kann. Auch hier muss eine geschlossene Linie die Fläche nicht mehr in zwei Teile teilen. Nun extrapoliert Exner wieder und fragt: müsste dann nicht auch ein Körper in sich zurückgebogenen werden können in einem vierdimensionalen Raum? Wäre es nicht möglich, mit einer geschlossenen Fläche (etwa eine Kugeloberfläche) den Körper in zwei Teile zu zerlegen, dann müsste der Körper in einer höheren Dimension mit sich selbst verbunden sein. Was Exner hier beschreibt bezeichnet man heute als Einbettung in eine höhere Dimension.
Verlust der Lichtintensität als Indiz der Dimensionalität
Dass unser Raum dreidimensional ist, so Exner, lässt sich nicht nur rein geometrisch zeigen. Auch bestimmte Naturphänomene deuten darauf hin. Geht etwa von einem Punkt im Raum aus Licht mit gleicher Stärke in alle Richtungen des Raumes weg, dann nimmt die Intensität mit der Entfernung ständig ab, und zwar quadratisch. Die Wirkung des Lichtes muss sich mit wachsender Entfernung von seiner Quelle nämlich über eine immer größere Kugeloberfläche verteilen. Und da die Kugeloberfläche quadratisch mit der Entfernung wächst, muss die Intensität abnehmen, da sie ja auf die Fläche bezogen ist. Anders sieht es in einer Ebene aus: verteilt sich das Licht nur in einer Ebene gleichmäßig, dann verteilt es sich mit zunehmender Entfernung auf eine immer größere Kreislinie. Der Kreisumfang aber wächst nicht quadratisch sondern nur linear mit der Entfernung. So könnte man von der Gesetzmäßigkeit der Lichtverteilung Rückschlüsse ziehen können auf die Dimensionalität des Raumes, in dem man sich befindet. [2, Seite 14]
Raumkrümmung
Um die Idee eines gekrümmten Raumes zu erklären, beginnt Exner bei den vier grundlegenden Axiomen Euklids über die Geometrie. Ihre Gültigkeit ist auf bestimmte Räume beschränkt, was aber Euklid, einem Denker der griechischen Antike, nicht bewusst war [1, Seite 18]:
- 1. Axiom: zwischen zwei Punkten im Raum gibt es nur genau eine kürzeste Verbindungsstrecke.
- 2. Axiom: zu einer Geraden lässt sich durch einen gegebenen Punkt nur genau eine parallele Gerade zeichnen
- 3. Axiom: es gibt kongruente Flächen, sie lassen sich durch reine Verschiebung ohne Deformation zur Deckung bringen.
- 4. Axiom: es gibt ähnliche Figuren: sie haben gleiche Winkel und unterscheiden sich maximal in ihrer Größe.
Ein Raum, in dem diese vier Axiome gelten nennt man auch euklidisch, oder nach Exner auch einen ebenen Raum. Exner zeigt nun Schritt-für-Schritt, dass man sich zweidimensionale Räume (Ebenen) vorstellen kann, in denen die vier Axiome des Euklid nicht mehr gelten. Dazu definiert er zunächst ein Krümmungsmaß.
Das Krümmungsmaß für Linien
Nimmt man eine Linie, etwa einen Faden, und legt diese auf einer Ebenen Fläche in einer geschwungen Form hin, dann leuchtet leicht ein, dass die Linie an allen stellen unterschiedlich stark gekrümmt sein kann, also unterschiedlich enge Kurven beschreibt. Man kann dann für jeden Punkt einer Linie sich einen Kreis denken, der möglichst genau dieselbe Form hat, wie die Linie in der nahen Umgebung dieses Punktes. Der Radius des so hinzugedachten Kreises ist der sogenannte Krümmungsradius σ (klein Sigma). Der Kehrwert von σ wird dann als Krümmungsmaß K definiert, nämlich als K/σ: je größer der Radius, desto kleiner die Krümmung und umgekehrt: je kleiner der Radius, desto stärker die Krümmung. Ein unendlich großer Radius, so Exner, ergäbe dann eine Krümmung 0, also keine Krümmung, also einen flachen (geraden) Raum. Dabei macht der Krümmungsradius keine Aussage darüber, wie groß der Weltraum ist, nur wie stark er gekrümmt ist. [7]
Das Krümmungsmaß für Flächen und Räume
Auch eine Fläche kann man sich gekrümmt vorstellen, etwa die Oberfläch eines sanft gewellten Hügels. Hier legt man an einen Punkt zwei Kreis an, die den Punkt mit ihrer Kreislinie nur berühren. Dabei müssen die zwei Kreise senkrecht aufeinander stehen. In jeder Richtung kann dann die Krümmung an dem Punkt der Ebene unterschiedlich sein. Mathematisch kann man das über sogenannte partielle Ableitungen beschreiben. Das Krümmungsmaß K ist dann: 1/(σ₁·σ₂). Und als Extrapolation denkt man sich für die (nicht anschauliche) Krümmung des Raumes rein formal das Krümmungsmaß: K = 1/(σ₁·σ₂·σ₃). Exner zeigt dann, wie man sozusagen von innen, aus einem so gedachten Raum heraus, feststellen könnte, ob der Raum in dem man lebt gekrümmt ist oder nicht. Siehe auch 👉 ebener Raum
Der gekrümmte Raum und die Gravitationskraft
Nach der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein (1879 bis 1955) ist die Gravitationskraft eine Folge des gekrümmten Raums. Der Physiker Stephen Hawking (1942 bis 2018) weist darauf hin, dass nicht nur Masse sondern auch Energie den Raum krümmt und damit eine Anziehungskraft ausübt. Er schreibt über die Anziehungskraft: "Man müsse sie vielmehr als Folge des Umstandes betrachten, daß die Raumzeit nicht eben sei, sondern gekrümmt oder verworfen durch die Verteilung der Massen und Energien in ihr [1, Seite 47]." Demzufolge hätte auch reine Energie eine gravitative, also anziehende Wirkung. Siehe auch 👉 Gravitationskraft