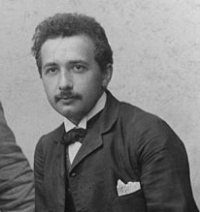Hochbegabung
Definition
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Die Marburger Rost-Studie|
Beispiele|
3. Klasse|
9. Klasse|
5. bis 9. Klasse|
8. Klasse|
Kindergarten|
Fußnoten
Basiswissen
Nach einer verbreiteten Definition beginnt Hochbegabung ab einem IQ von 130. Diesen erreichen nur etwa 2,3 Prozent der Bevölkerung. Auf Schulklassen übertragen heißt das aber, dass immerhin im Durchschnitt bei zwei normalen Schulklassen von je 25 Schülern ein hochbegabter Schüler darunter ist.
Die Marburger Rost-Studie
Um die 1990er Jahre wurde an der Universität Marburg eine der weltweit umfangreichsten Studien zu hochbegabten Schülern durchgeführt.[9] Dabei wurden Schüler sowie Personen aus ihrem Umfeld über viele Jahre hinweg beobachtet und befragt. Neben hochbegabten Schülern, die alleine am gemessenen IQ erkannt wurden, wurden auch hochleistende Schüler als eigene Gruppe betrachtet. Die hochleistenden Schüler wurden einzig über herausragende schulische Leistungen definiert. Die Autoren der Studie kamen im Wesentlichen zu dem Schluss, dass hochbegabte Schüler außer ihrer Hochbegabung kaum von durchschnittlichen anderen gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen abwichen:
- Etwa 2 Prozent der Schüler haben einen IQ von 130 und gelten damit als Hochbegabt.[10]
- Hochbegabung ist relativ zeitstabil, ändert sich also über die Jahre eher nicht.[10]
- Der durchschnittliche IQ der Hochleistenden lag bei 117.[9]
- 15 % der Hochleister (in der Klasse 9) waren auch hochbegabt.[9]
- 15 % der Hochleister (in der Klasse 9) hatten einen durchschnittlichen IQ.[9]
- Weniger als ein Sechstel der Hochbegabten sind auch Minderleister.[9]
- Hochbegabte zeigen keinen besonderen, von anderen abweichende Denkstil.[13]
- Hochbegabte und hochleistende Schüler sehen sich nicht als Außenseiter.[10]
- Hochbegabte zeigen keine auffälligen Persönlichkeitsmerkmale.[11]
- Hochbegabte und Hochleistende wären ähnlich zufrieden wie durchschnittlich Begabte.[12]
Das Fazit der Marbuger Rost-Studie war: im großen Durchschnitt sind Hochbegabte und Hochleistende gut in die Schule intergriert. Sie zeigen gegenüber durchschnittlich Begabten keine besonderen Persönlichkeitsmerkmale, schon gar keine problematischen. Sie sind wie andere Kinder und Jugendliche auch.[14]
Beispiele
3. Klasse
Ein Junge, nennen wir ihn Theo, der seit erst zwei Monaten in der dritten Klasse ist zeigt ein außerordentlich großes Interesse an theoretischer Mathematik. Theo wird von seinen Eltern sehr gefördert und kommt ein mal die Woche für drei Stunden in den offenen Nachmittag in unserer Lernwerwerkstatt. Die Aufgabe 555 mal 555 löste er ohne Kenntnis der schriftlichen Multiplikation in etwa einer Minute mit Hilfe nur einer als Zwischenergebnis notierten Zahl. Dabei hatte er selbst erkannt, dass man erst 5 mal 555 rechnen könne, dann 50 mal 555 und am Ende 500 mal 555 und dann alle drei Zwischenergebnisse addiert. Dass die beiden letzten Multiplikationen durch Anfügen von einer beziehungsweise zwei Nullen aus der ersten Multiplikationen folgen hatte er ebenfalls selbst erkannt. Theo hat bereitwillig praktische Aufgaben wie etwa das Zählen der Sandkörner in einem Kubikzentimeter bearbeitet. Er gab sich dabei auch Mühe und war einigermaßen interessiert. Aber er sagte von sich aus, dass er am liebten große, lange, schwere Aufgaben machen, wo man nur an der großen Tafel steht und denkt. Und tatsächlich kann er sich stundenlang alleine mit solchen Dingen vor der Tafel sitzend beschäftigen. Um auch die oberen Bereiche der 2 mal 1 Meter großen Wandtafel nutzen zu können klettert er auf eine Stehleiter. Typische solche Aufgaben sind: finde zu jeder der 9 Ziffern unserer Zahlen mindestens drei Quadratzahlen, die auf diese Ziffer enden. Dabei formulierte er schnell die (korrekte) Vermutung, dass das bei den Ziffern 2, 3, 7 und 8 nicht funktionieren könnte. Theo fügt sich reibungslos in die Gruppe ein, sagt aber ausdrücklich, dass er am liebsten die Tafelaufgaben für sich alleine machen möchte. Nach seinen Lieblingsfächern in der Schule gefragt nannte er die Sachkunde. Er sprudelte darauf hin mit Wissen aus den Bereichen Astronomie und Erdgeschichte.
9. Klasse
Eine Schülerin, Lisa sei ihr Name, besuchte uns einmal die Woche seit Beginn der 9. Klasse. Dabei hatte sie die 8. Klasse gerade übersprungen. Sie ist sehr interessiert an erkenntnistheoretischen Gedanken. Dabei kann sie sich stundenlang alleine mit den mathematischen Gesetzen zum elastischen Stoß beschäftigen, bringt sich dabei alleine die Lösung linearer Gleichungssysteme bei, dreht weitgehend eigenständig Videos zum Zusammenstoß zweier Kugeln und wertet diese rechnerisch aus (potentielle Energie aus Anlauframpe in Geschwindigkeit der Kugel umrechnen). Auch das Hochladen solcher Videos auf Plattformen im Internet eignet sie sich weitgehend alleine an. Auffällig ist, wie stark sie in an den philosophischen Bedeutungen interessiert ist. Die physikalischen Gesetze zum Stoß werden gerade dadruch interessant, dass sie in einem gut nachvollziehbaren Zusammenhang zu kosmologischen Gedanken über die Zukunft des Universum stehen (Entropie, Wärmetod) oder die Frage der eindeutigen Vorausberechenbarkeit der physikalischen Welt (Dreifachstoß, Determinismus) berühren.
5. bis 9. Klasse
Seit der fünften Klasse und jetzt in der 9. Klasse besucht uns einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden ein Junge mit diagnostizierter Hochbegabung. Von Anfang an war es der Wunsch der Eltern, dass wir gemeinsam mit ihm nur interessante Dinge tun. Nach dem Schulstoff bräuchten wir nicht zu sehen. Die Eltern fördern ihn sehr, etwa im Musischen Bereich, mit Ausflügen und interessanten Urlauben. In der Schule kommt der Junge überall recht gut mit, kämpft aber sichtbar immer wieder auch mit denselben Verständnisproblemen wie andere nicht hoch begabte Schüler. Was diesen Jungen vor allem auszeichnet ist die Beständigkeit, die Ausdauer, mit der er sich in große komplexe Themen oder dazugehörige Details "hineinfrisst". Er hatte etwa Freude daran, sich über ein Jahr lang nur mit der Herstellung von Wasserstoff zu beschäftigen, oder mit dem Bau und Betrieb einer Wellenwanne oder der freiäugigen Astronomie. Der Junge ist äußergwöhnlich selbständig. Über Stunden hinweg baut er sich Geräte für Versuche zusammen. Er entwickelt und testet systematisch Detailideen, kann im Kopf problemlos zwischen dem Gesamtüberblick und Detailfragen wechseln. In Gesprächen sucht er weniger Anleitungen als Vielmehr einen Austausch von Ideen. Auffällig ist, dass ihn die Verbindung von mathematisch-abstrakter Theorie mit der Welt der Praxis fasziniert. Ein Beispiel ist, wie gut die Formeln quadratischer Funktionen und der Fallgesetze der Physik auf eigene Versuch zum Wurf einer Bleikugel von einer Brücke passten, wie man mit der Trigonometrie und einem Pendelquadranten Baumhöhen messen kann oder wie eine Formel (sehr kompliziert) für einen Detektor für einen Tsunami aussehehen könnte, der an nur zwei Stellen im Meer ausschließlich den Durchgang einer Welle mit Zeitstempel feststellt und daraus die Richtung und Geschwindigkeit der Welle berechnet.
8. Klasse
Ein diagnostiziert hochbegabter Junge aus der Klasse reiste im Jahr 2024 einmal wöchentlich über 70 Kilometer mit dem Zug zu uns für eine Einzelstunde an. Er wirkte von seinem Äußeren her schüchtern aber sehr gut erzogen. In der Schule erzielte er unter anderem in Mathematik dauerhaft sehr schlechte Noten. Formale Rechenregeln konnte er weder verstehen noch rein pragmatisch nutzen. So blieben unsere Bemühungen zum formalen Lösen linearer Gleichungssysteme über mehrere Stunden hinweg erfolglos. Verblüffend, aber in der Szene der Hochbegabten kein Einzelfall, war folgende Wendung. Ich lernte mit ihm zuächst, die Lösungsmenge von Gleichungen mit drei Unbekannten als Raumgebilde in einem 3D-Koordinatensystem mit x-, y- und z-Achse zu visualisieren. Das gelang schnell und mühelos. Er konnte dann gut und schnell etwa die Lösung von x+2y+z=20 grob als Ebene im Raum in einem bloß gedanklich vorgestellten Koordinatensystem visualisieren. Ließ ich die dritte Unbekannte z weg, ergaben die entsprechenden Lösungsmengen Geraden auf dem "Boden des Koordinatensystems". Gab ich ihm nun zwei solche 3D-Geradengleichungen, fand er die Lösung des entsprechenden linearen Gleichungssystems recht gut. Formulierte ich dasselbe Problem in einem 2D-Koordinatensystem, konnte er die Aufgaben nicht mehr lösen. Hier wiederholte sich eine Beobachtung, die ich auch an manchen anderen Hochbegabten machen konnte: erst wenn Fragen mit ausreichend viel Komplexität, oft als Raumstrukturen, angereichert ist, werden sie für diese Kinder greifbar. Der für andere Schüler vorteilhafte Weg, erst einmal viel Komplexität weg zu lassen, ist für diesen Typ von Hochbegabten eine Sackgasse. Auffällig war auch, dass er sich zuhause alleine nicht systematisch und längere Zeit alleine mit intellektuellen Themen beschäftigte. Misserfolge in der Schule hatten sein Selbstvertrauen sichtbar beeinträchtigt. Sein Äußeres strahlte Fügsamkeit und Depression gleichermaßen aus. An der Schule des Jungen zeigte sich kein Lehrer trotz Klassenkonferenzen und weiterer Bemühungen der Eltern bereit, individuell auf ihn einzugehen. Nach langer Suche fand sich letztendlich in über 100 km Entfernung ein Internat, in dem er sich letzten Endes wohl fühlte.
Kindergarten
Im Jahr 2023 begann ein Junge, gerade erst fünf Jahre alt geworden, wöchentlich einmal für zwei Stunden in unsere Lernwerkstatt in Aachen zu kommen. Das Kind war sehr aufgeschlossen und stellte sofort die Frage, wie denn die Ringe des Saturn entstanden seien. Die etwas ausweichende[1] Antwort, dass diese Ringe aus einem ehemaligen Mond entstanden sein könnten stellte ihn zufrieden. Beim Anblick einer historichen Pendeluhr sagte er sofort, dass die römische Zahl IV dort falsch sei, tatsächlich war sie geschrieben als IIII, was mir (56 Jahre alt) noch nie aufgefallen war[2]. Bei einem physikalischen Versuch[3] erkannte er sofort die Folgen: aus einer rundum geschlossenen Flasche, randvoll mit Spiritus, ragte oben ein langer zur Seite hin etwas neigender Strohhalm heraus. Ich sagte dem Jungen, dass der Spiritus bei Erwärmung mehr Raum bräuchte. Sofort sagte er, dass man dann unter das Ende des Strohhalms einen Behälter stellen müsste, um den dann heraustropfende Spiritus aufzufangen.[4] Spontan frug der Junge dann, warum Zahlen nie aufhören. Ich brachte die Uhrzeiten als Gegenspiel: dort hören die Zahlen nach der Zwölf auf. Er folgte dem Gedanken sofort und zählte richtig: 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3.
Fußnoten
- [1] Die Darlegung der wirklichen physikalischen Gründe hätte er wahrscheinlich nicht verstanden Roche-Grenze ↗
- [2] Tatsächlich ist die IIII für IV bei alten Uhren sehr verbreitet Engadiner Holzräderuhr">IV ↗
- [3] Der Versuch ist beschrieben unter Spiritusausdehnungsversuch ↗
- [4] Mathematisch ist das ein zyklisches Zahlensystem ↗
- [5] Teilbereiche des Kortex, der Großhirnrinde scheinen statistisch eine positive Korrelation zwischen ihrer Dicke in Millimetern und dem gemessenem IQ, insbesondere dem allgemeinen Intelligenzfaktor, auch g-Faktor genannt, zu haben: K. Menary et al.: Associations between cortical thickness and general intelligence in children, adolescents and young adults. Intelligence. 2013 Sep;41(5):597-606. doi: 10.1016/j.intell.2013.07.010. PMID: 24744452; PMCID: PMC3985090.
- [6] Gute Übersicht zum Stand der Modelle: Karin Busch, Ulrike Reinhart: Akademielehrgang Begabungsförderung. Modul 1. Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ. 2005. Online: https://web.archive.org/web/20120112093224/http://assi.educanet2.ch/agbegabtenfoerderung/.ws_gen/9/Theoretische_Grundlagen_zum_Begabungsbegriff.pdf
- [7] Im Zusammenhang mit scheinbar langsam denkenden Hochbegabten wird empfohlen, "nicht nur auf die 'testintelligenten' Schüler achten“ solle, sondern „auch auf grüblerische, besonders selbstkritische, manchmal vielleicht sogar zunächst langsam wirkende Denker. Lerntests“" - J. Guthke: Lerntests auch für Hochbegabte? In: Hany, E.A./Nickel, H. (Hrsg.): Begabung und Hochbegabung. Theoretische Konzepte – Empirische Befunde – Praktische Konsequenzen. – Bern: Huber, 1992. Dort die Seite 134.
- [8] Robert J. Sternberg, E. L. Grigorenko: Thinking Styles and the Gifted. Roeper Review, 16, 122-130. 1993. Online: https://doi.org/10.1080/02783199309553555
- [9] Detlef H. Rost (Hrsg.): Hochbegabte und hochleistende Jugendliche. Befunde aus dem Marburger Hochbegabtenprojekt. 2., erweiterte Auflage. Waxmann, Münster 2009, ISBN 978-3-8309-1997-1.
- [10] Arnold, Karl-Heinz: Rost, D.H. (Hrsg.)(2000): Hochbegabte und hochleistende Jugendliche. Münster: Waxmann. 421 Seiten. Rezension in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 50 (2001) 4, S. 316-317 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-23874 - DOI: 10.25656/01:2387
- [11] Inez Freund-Braier: Hochbegabung, Hochleistung, Persönlichkeit. Waxmann. Münster, 2001. ISBN 3-8309-1070-3.
- [12] Linda Wirthwein: Mehr Glück als Verstand. Zum Wohlbefinden Hochbegabter. Dissertation. Philipps-Universität, Marburg. DOI: doi:10.17192/z2010.0630
- [13] "Bislang ist es noch nicht gelungen, qualitative Unterschiede zwischen Hochbegabten und durchschnittlich Begabten ausfindig zu machen. Fragen wie „Denken Hochbegabte prinzipiell anders?“ oder „Liegen bei Hochbegabten andere Denkstrukturen vor?“ können bis heute noch nicht begründet bejaht werden." In: Detlef Rost: Begabung, Intelligenz, Hochbegabung. Was wird unter „Hochbegabung“ verstanden? Hochbegabung und Schule. Herausgegeben vom Hessischen Kultusministerium. Mai 2008. Online: https://www.uni-marburg.de/de/fb04/therapie-und-beratung/brain/flyer/hochbegabung_und_schule.pdf
- [14] Walter Diehl: Hochbegabte sind in erster Linie Kinder und Jugendliche wie andere auch. Forschungsergebnisse aus der empirischen Längsschnittstudie „Marburger Hochbegabtenprojekt“. In: Hochbegabung und Schule. Herausgegeben vom Hessischen Kultusministerium. Mai 2008. Online: https://www.uni-marburg.de/de/fb04/therapie-und-beratung/brain/flyer/hochbegabung_und_schule.pdf