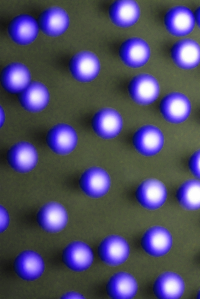Billardkugelwelt
Physik
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Was meint Billardkugelwelt?|
Woher stammt das Denkbild?|
Wo passt das Denkbild sehr gut?|
Wozu dient dieses Denkbild heute?|
Kritik des Billardkugelmodells der Welt|
Einschränkungen durch die Chaostheorie|
Mehrfachstöße der Mechanik|
Quantenhebel|
Zeitsymmetrie in der Billardkugelwelt|
Der Zeitpfeil in der Billardkugelwelt|
Fußnoten
Basiswissen
Die Billardkugelwelt ist ein metaphorisches Denkbild für ein mechanistisches Universum: die Welt besteht aus kleinsten Materieteilchen, die sich nach einigen festen und alternativlos wirkenden Naturgesetzen verhalten. Das ist hier weiter erklärt.
Was meint Billardkugelwelt?
Als Billardkugelwelt bezeichnet man heute ein inzwischen überholtes, ganz mechanistisches Weltbild. Man stellte sich die Welt so vor, als sie aus kleinsten, materiellen Teilchen aufgebaut. Diese Teilchen bewegen sich dann ganz nach den Gesetzen der Newtonschen Mechanik:
ZITAT:
"Mit einem speziellen Kraftgesetz […] entsteht aus dem Newtonschen Regelwerk ein präzise festgelegtes System von dynamischen Gleichungen. Werden die Positionen, Geschwindigkeiten und Massen der verschiedene Teilchen zu einer Zeit vorgegeben, so sind ihre Positionen und Geschwindigkeiten […] für alle späteren Zeiten mathematisch determiniert."[9]
"Mit einem speziellen Kraftgesetz […] entsteht aus dem Newtonschen Regelwerk ein präzise festgelegtes System von dynamischen Gleichungen. Werden die Positionen, Geschwindigkeiten und Massen der verschiedene Teilchen zu einer Zeit vorgegeben, so sind ihre Positionen und Geschwindigkeiten […] für alle späteren Zeiten mathematisch determiniert."[9]
Der Mathematiker und Nobelpreisträger Roger Penrose, von dem das Zitat oben stammt, bezeichnet dieses Modell dann einige Zeilen als "Newtonsches Billardkugelbild der Realität" oder kurz auch als "Billardkugelwelt":[9] Wie die Kugeln auf einem Billardtisch, so bewegen sich auch die gedachten Materie-Kugeln der gesamten Welt nach festen Naturgesetzen.
Woher stammt das Denkbild?
- Sinngemäß beschrieben wurde es von dem antiken Philosophen Lukrez ↗
- Er beschrieb eine Welt aus kleinsten, feinstofflichen Kugeln.
- Aus deren Wechselwirkungen soll unsere ganze Welt bestehen.
- Die Antike Atomvorstellung ist näher betrachtet im Artikel Atomon ↗
Wo passt das Denkbild sehr gut?
- In der Physik passt es sehr gut auf die kinetische Gastheorie[3] ↗
- In ihr stellt man sich Gasteilchen als kleinste Kügelchen vor.
- Solange sie nicht aufeinanderprallen fliegen die Kügelchen immer geradeaus weiter.
- Ein Zusammenprall ist immer ein elastischer Stoß ↗
- Ein so gedachtes Gas nennt man ein ideales Gas ↗
- Es ist eigentlich eine Billardkugelwelt.
Wozu dient dieses Denkbild heute?
- Es dient als Sinnbild für ein mechanistisches Welt.
- Wer ein mechanistisches Weltbild hat, glaubt, dass sich alles in der Welt ...
- auf einige wenige ähnliche Dinge und einige wenige mechanische Bewegungsgesetze zurückführen lässt.
- Mechanistische Weltbilder waren vor allem zwischen 1700 und 1900 sehr verbreitet.
- Sie sind ein Sonderfall des Determinismus [alles ist vorherbestimmt] ↗
- Der Determinismus war immer und ist auch heute stark umstritten.
Kritik des Billardkugelmodells der Welt
Einschränkungen durch die Chaostheorie
In der Chaostheorie wird Billard als Beispiel für ein sogenanntes deterministisches Chaos behandelt: bereits kleinste, mikroskopische Veränderung an der Richtung oder der Geschwindigkeit einer Kugel wirken sich schon nach wenigen Kollisionen auf makroskopischer Ebene stark erkennbar aus. In einem sogenannten Bunimowitsch-Stadion prallt eine Kugel mit elastischen Stößen an den Banden eines Billardtisches ohne Löcher ab. Dieses einfach zu denkende Modell führt aber schnell zu großen Unvorhersagbarkeiten im Verhalten einer Kugel.[4] Siehe dazu auch Chaostheorie ↗
Mehrfachstöße der Mechanik
Stoßen zwei Kugeln mit bekannten Geschwindigkeiten und bekannten Richtungen aufeinander, so kann man mathematisch eindeutig vorausberechnen, mit welchen Geschwindigkeiten und in welche Richtungen sie sich wieder trennen. Stoßen die Kugeln einer Billardkugelwelt also immer nur paarweise aneinenader, so ist diese Welt bis in alle Ewigkeit vorausberechenbar. Sie ist vorherbestimmt, oder determiniert. Das gilt aber nicht für Dreifach- und höhere Mehrfachstöße: für solche Stöße kann man mathematisch nicht vorausberechnen, wie sich die Kugeln wieder voneinander trennen.[9] Siehe mehr unter Dreikörperproblem ↗
Quantenhebel
Die Atome einer Billardkugel sowie auch des Spieltisches verhalten sich im mikroskopischen Bereich betrachtet quantenhaft. Das heißt, sie unterliegen Unschärfen im Bezug auf Energien, Orte und Impulse.[5] Wenn diese Größen für die Atome aber nicht genau bestimmt sind, dann könnten kleinste Abweichungen auf dieser mikroskopischen Quantenebene sich fortpflanzen bis auf die sichtbare Ebene der makroskopischen Welt. Man denke hier an den berühmten Schmetterlingseffekt der Chaostheorie.[6]
Zeitsymmetrie in der Billardkugelwelt
Anhand des Billardspiels kann man sich auch die Idee von irreversiblen Vorgängen anschaulich machen. Man filme dazu etwa zunächst den Zusammenstoß von zwei Billardkugeln. Man kann dann den Film einmal vorwärts und einmal rückwärts laufen lassen. Man kann dann eine andere Person fragen, welche der zwei Versionen die echte, die originale war. Macht man den Versuch mit mehreren Personen, werden wahrscheinlich nicht alle richtig anworten.
Zwei Kugeln aus Holz stoßen aneinander. Sowohl vorwärts wie auch rückwärts abgespielt, wirkt die Kollision realistisch.
interessant dürfte auch die Frage sein, woran die Betrachter des Films entscheiden wollen, welcher den realen Vorgang zeigt. Tatsächlich geben die Gesetze der newtonschen Mechanik keinerlei Hinweis darauf.[7] Die Bewegung der Kugeln erscheint vorwärts wie rückwärts gleichermaßen realistisch. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer T-Symmetrie">Zeitsymmetrie ↗
Der Zeitpfeil in der Billardkugelwelt
Interessant wird es dann aber, wenn man die Eröffnung eines Spiels von Poolbillard filmt. Am Anfang des Spieles werden die 15 farbigen Bälle zu einem Dreieck zusammengelegt. Mit der weißen Kugel wird dann auf dieses Dreieck geschossen. Nach dem Auftreffen der weißen Kugel, stieben die 15 farbigen Bälle in unterschiedliche Richtungen auseinander. Lässt man diesen Film rückwärts laufen, erkennt jeder Betrachter sofort, dass dies nicht die originale Version sein kann: rückwärts laufend würde man 16 Bälle sehen, die aus verschiedensten Richtungen aufeinander zulaufen, sich dann in einem Dreieck zusammenfinden, wobei dann 15 der Bälle in dieser Dreiecksform zur Ruhe kommen während ein Ball, die weiße Kugel, mit hoher Geschwindigkeit weggestoßen wird. Dieser Ablauf ist nach den newtonschen Gesetzen völlig in Ordnung und möglich. Aber jede Erfahrung sagt, dass er extrem unwahrscheinlich ist und so wahrscheinlich auch niemals stattfinden wird.[8] Damit gibt es auf einmal eine Ausnahme von der Zeitsymmetrie: wenn man viele Kugeln miteinander ins Spiel bringt, scheint es plötzlich Abläufe zu geben, die realistischer erscheinen als andere. Diese Beobachtung führt über sogenannte irreversible Prozesse letztendlich hin zu einer anschaulichen Begründung für die sogenannte Entropie in der Thermodynamik. Ein guter Einstiegspunkt hin zu diesem Gedanken ist der Artikel zum Zeitpfeil ↗
Fußnoten
- [1] Ludwig Boltzmann, einer der Mitbegründer der kinetischen Gastheorie, beschreibt ein einfaches Billard-Kugel-Modell für Gase: "Wir wollen da zuerst einen thunlichst einfachen Körper der Betrachtung unterziehen, nämlich ein von festen absolut elastischen Wänden eingeschlossenes Gas, dessen Moleküle harte, absolut elastische Kugeln sind. Oder Kraftcentra, welche nur, wenn ihre Entfernung kleiner als eine gewisse Grösse geworden ist, nach einem übrigens beliebigen Gesetze, sonst aber gar nicht auf einander wirken". Billarbälle aus hartem Phenolharz kommen den Boltzmannschen "absolut elastischen Kugeln" recht nahe. In: Ludwig Boltzmann: Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung respektive den Sätzen über das Wärmegleichgewicht. In: Sitzungsber. d. k. Akad. der Wissenschaften zu Wien II 76, S. 428 (1877). Nachdruck in Wissenschaftliche Abhandlungen von Ludwig Boltzmann, Band II., S. 164–223. Siehe auch kinetische Gastheorie ↗
- [2] Dass die Atome keine Billardkugeln sein können, war spätestens seit den Streuversuchen Rutherfords um 1911 bekannt: Rutherfords "scattering experiments proved that the atom was able to exert large electrical forces which would be impossible unless the positive charge acted as a highly concentrated source of attraction; it must be contained in a nucleus minute in comparison with the dimensions of the atom. Thus for the first time the main volume of the atom was entirely evacuated, and a “solar system” type of atom was substituted for a substantial “billiard-ball”. Two years later Niels Bohr developed his famous theory on the basis of the Rutherford atom, and since then rapid progress has been made. Whatever further changes of view are in prospect, a reversion to the old substantial atoms is unthinkable." In: Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort "Chapter I The Downfall of Classical Physics". Das Atom als kleines Sonnensystem ist behandelt im Artikel saturnisches Atommodell ↗
- [3] Zur Analogie zwischen Billard und Gasen heißt es etwa: "Thermodynamics lets us make precise predictions about averaged (over all the particles) properties of complicated, many-body systems, like millions of billiard balls or atoms bouncing around, without needing to know the gory details. We can make these predictions by introducing the notion of probabilities. Even though the system is deterministic – we can in principle calculate the exact motion of every ball – there are so many balls in this system, that the properties of the whole will be very close to the average properties of the balls." Und dann: "For a practical example – instead of billiard balls, consider a gas of air molecules". In: Aleksander Lasek: My experimental adventures in quantum thermodynamics. Quantum Frontiers. A blog by the Institute for Quantum Information and Matter @ Caltech. March 24th, 2024.
- [4] Billard als Beispiel für ein deterministisches Chaos wird betrachtet in: der Artikel "Bunimowitsch-Stadion" Spektrum Lexikon der Physik. 6 Bände. Greulich, Walter (Hrsg.) Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg, Berlin. 1998-2000. Online: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/bunimowitsch-stadion/2100
- [5]. Wie würde ein Billard-Spiel aussehen, wenn sich die Kugeln wie Quanten verhielten? In: Gamow G. Quantum Billiards. In: Mr Tompkins in Paperback. Canto. Cambridge University Press; 1993:65-84. Mit einem Vorwort von Roger Penrose ↗
- [6] Edward N. Lorenz: Predictability: Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? Titel des Vortrags vom 29ten Dezember 1972 auf der Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science; laut Science 320, 2008, S. 431. Siehe mehr unter Schmetterlingseffekt ↗
- [7] Der Stoß von zwei Billardkugeln erscheint symmetrisch bezüglich einer Spielegelung in der Zeit zu sein: "Some changes are symmetric in the sense that they are just as natural run forwards or backwards. This is approximately the case with the collision of two billard balls in the absence of friction. Play the movie of a collision both forwards and backwards and it will be difficult to discern which is the 'real' version." Und: "Newtons laws of motion are symmetric". In: Terrence W. Deacon: Incomplete Nature. How Mind Emergend from Matter. W. W. Norton. New York. London. 2012. Dort im Kapitel "7 Homeodynamics". Seite 219 und 220. Siehe mehr unter T-Symmetrie [Zeitsymmetrie] ↗
- [8] Das Beispiel mit Poolbillard im englischen Original: "But if the movie [of colliding billard balls] involves fifteen balls colliding with one another, it will often be quite obvious which sequence is shown forwards and which is shown backwards. And this doesn't depend on energy being added or friction slowing the velocities. Even on an imaginary frictionless billiard table, this can be discovered as long as one begins with an asymmetrically organized arrangement. Thus the breaking up of a symmetrically organized triangular array of balls (as in a pool 'break') so that they beome scattered and careen [sic] around the table will be the obvious forward direction, whereas a reversal of this movie will appear quite unnatural." In: Terrence W. Deacon: Incomplete Nature. How Mind Emergend from Matter. W. W. Norton. New York. London. 2012. Dort im Kapitel "7 Homeodynamics". Seite 220. Dieser Gedanke führt letztendlich zum Konzept der Entropie ↗
- [9] Roger Penrose: Computerdenken. Des Kaisers neue Kleider oder Die Debatte um Künstliche Intelligenz, Bewußtsein und die Gesetze der Physik. Englischer Originaltitel: The Emperor's New Mind (1989). Deutsche Ausgabe: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH. Heidelberg. 1991. ISBN: 3-89330-708-7. Dort im Kapitel "5. Die klassische Welt", Seite 164.