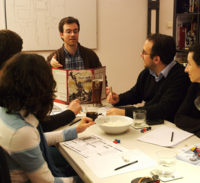Milieutheorie
Soziologie
© 2016
- 2026
Basiswissen|
Schlaglichter auf die Historie der Milieutheorie|
1748: La Mettries Maschine Mensch|
1863: Hippolyte Taines Milieu, Rasse und Umstand|
1900: Thorstein Veblen: das Milieu der Reichen|
1935 und später: Fachkulturen als Milieus|
1960er Jahre: Pierre Bourdieu: Milieus im Alltag|
2020: Die Milieutheorie in der Marktforschung|
Zwischen Selbstbestimmung und Funktionalität|
Milieus und Arbeitsteilung|
Milieus als Katalsysator einer Soziogenese|
Fußnoten
Basiswissen
Der Mensch wird in seinem Verhalten ganz von seiner Umgebung, seinem Erbgut und seinem sozialen Milieu beeinflusst, nicht etwa durch einen freien Willen: die Milieutheorie entstand im 19ten Jahrhundert, mit ideengeschichtlichen Wurzel die tief im mechanistischen Denken des 18ten Jahrhunderts verankert waren. Heute steht der Begriff der Milieutheorie jedoch einschränkend dafür, dass nur die soziale Umwelt und nicht die Gene (also das Erbmaterial) unser Verhalten beeinflussen [6]. Das ist hier kurz vorgestellt.
Schlaglichter auf die Historie der Milieutheorie
Dass das Umfeld in dem man lebt einen mehr oder minder großen Einfluss auf das konkrete Verhalten einzelner Menschen hat, bedarf als offensichtlicher Lebensweisheit keiner wissenschaftlichen Begründung. Spricht man aber von einer Theorie, so deutet man damit doch eine mehr oder minder wissenschaftliche Haltung an, aus der heraus etwas betrachtet wird. Wie der Mensch durch sein Milieu geprägt wird und was das für die Entwicklung von Gesellschaften bedeuten kann hat als wissenschaftlicher Gedanke seinen Wurzeln im mechanistischen Denken des 18ten Jahrhunderts und hat sich seitdem zu einer wirkmächtigen Strömung innerhalb der Soziologie weiter entwickelt.
1748: La Mettries Maschine Mensch
Mit dem Erstarken mechanistisch geprägter Versuche einer Welterklärung im 18ten Jahrhundert begann man auch den Menschen als reines Produkt seiner Umwelt zu sehen. Großes Aufsehen erregte in dieser Zeit die Schrift "Die Maschine Mensch" des Franzosen Julien Offray de la Mettrie:
ZITAT:
"Man hat einen Menschen abgerichtet wie ein Thier; man ist Schriftsteller geworden wie Lastträger. Ein Geometer hat erlernt die schwersten Beweise und Berechnungen darzulegen, wie ein Affe seinen kleinen Hut abzunehmen oder aufzusetzen und auf seinem gelehrigen Hunde zu reiten. Alles ist durch Zeichen zu Wege gebracht; jede Art hat begriffen, was sie begreifen konnte, und so haben die Menschen auf diese Weise die symbolische Erkenntniss, wie selbige von unseren deutschen Philosophen noch heute genannt wird, erlangt. Man sieht also, nichts ist so einfach wie die Mechanik unserer Erziehung! Alles lässt sich auf Töne oder auf Worte zurückführen, die von dem Munde des einen durch das Ohr des andern ins Gehirn gehen, welches zu gleicher Zeit vermittelst der Augen die Gestalt der Körper erhält, deren willkürliche Zeichen diese Worte sind." [11]
"Man hat einen Menschen abgerichtet wie ein Thier; man ist Schriftsteller geworden wie Lastträger. Ein Geometer hat erlernt die schwersten Beweise und Berechnungen darzulegen, wie ein Affe seinen kleinen Hut abzunehmen oder aufzusetzen und auf seinem gelehrigen Hunde zu reiten. Alles ist durch Zeichen zu Wege gebracht; jede Art hat begriffen, was sie begreifen konnte, und so haben die Menschen auf diese Weise die symbolische Erkenntniss, wie selbige von unseren deutschen Philosophen noch heute genannt wird, erlangt. Man sieht also, nichts ist so einfach wie die Mechanik unserer Erziehung! Alles lässt sich auf Töne oder auf Worte zurückführen, die von dem Munde des einen durch das Ohr des andern ins Gehirn gehen, welches zu gleicher Zeit vermittelst der Augen die Gestalt der Körper erhält, deren willkürliche Zeichen diese Worte sind." [11]
Der Autor, la Mettrie, wurde zu seiner Zeit stark angefeindet. Selbst in den damals toleranten Niederlanden wurde er nicht geduldet. Erst am Hof des Preußenkönigs Friedrich II in Potsdam erhielt la Mettrie einen (engen) Freiraum. Man begreift die polarisierende Wirkung des ganz und gar materialistischen Denkens eines la Mettrie vielleicht erst dann, wenn man sich gleichzeitig auch auf mehr religiös geprägte Gedankenwelten einlässt. In diesen ist der Mensch nicht zufälliges Produkt seiner Umwelt sondern Ausdruck und Ebenbild eines göttlichen Willens und Träge einer Würde. Die provokativen Sichten eines la Mettrie waren aber dennoch Vorzeichen einer neuen Strömung wissenschaftlichen Denkens, die dann im 19ten Jahrhundert eine klare Gestalt annahm.
1863: Hippolyte Taines Milieu, Rasse und Umstand
Im 19ten Jahrhundert floss mechanistisches Gedankengut zunehmend in die Behandlung soziologischer Themen mit ein. Man denke hier beispielhaft an Darwins Evolutionstheorie aus dem Jahr 1860. Es war der Franzose Auguste Comte (1798 bis 1857) der das Programm einer streng logisch rein wissenschaftlichen Begründbarkeit menschlichen Verhaltens skizzierte. [12] Comte war es auch, der seinem Landsmann Hippolyte Taine (1828 bis 1893) die Idee zugestand, den Einfluss des Milieus auf den Menschen klar in einer mechanistischen Form [13] ausformuliert zu haben. Taine dachte streng in Ursachen und Wirkungen:
ZITAT:
"Das Laster und die Tugend sind Produkte wie Vitriol und Zucker, und jede komplexe Gegebenheit entsteht durch das Zusammentreffen anderer, einfacherer Gegebenheiten, von denen sie abhängt. Suchen wir also die einfachen Gegebenheiten für die moralischen Eigenschaften, so wie man sie für die physischen Eigenschaften sucht.“ [14]
"Das Laster und die Tugend sind Produkte wie Vitriol und Zucker, und jede komplexe Gegebenheit entsteht durch das Zusammentreffen anderer, einfacherer Gegebenheiten, von denen sie abhängt. Suchen wir also die einfachen Gegebenheiten für die moralischen Eigenschaften, so wie man sie für die physischen Eigenschaften sucht.“ [14]
Hippolyte Taines Gedanken passen in den Zeitgeist. In den 1840er Jahren arbeiten die deutschen Karls Marx und Friedrich Engels an ihrer Theorie, dass der Gang der Geschichte logischen "materiellen" Notwendigkeiten folgt. Taine sucht dann die tieferen Ursachen menschlichen Verhaltens [1]. In der Suche nach den Ursachen kommt dann die Idee des Milieus ins Spiel:"
Unter Rasse versteht Taine eine Gruppe von Menschen mit einer bestimmten ererbten Neigung zu denken und zu fühlen. [16] Das Milieu bildet die innere Struktur, in der eine Rasse lebt. [17] Beispielhaft führt er dazu die geographischen Unterschiedliche in denen germanische und lateinische Völker siedeln an und begründet damit ihre unterschiediche Haltung etwa zu Krieg, Spiel und Handel. [18] Mit Moment schließlich meint Taine einen bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte. Denn je nach dem gewählten Zeitpunkt, können dieselben Ursachen andere Wirkungen hervorbringen. [19]
Bei Hippolyte Taine sehen wir die Idee des Milieus als eine von drei Ursachen menschlichen Verhaltens nicht nur im Sinne eine isolierten Behauptung in den Raum gestellt. Vielmehr ist der Einfluss des Milieus Teil eines umfassenderen gedanklichen Konstrukts formuliert. In diesem Sinn eines Drangs hin zu komplexeren soziologischen Gedankengebäuden kann Taine somit als Urheber einer Milieutheorie angesehen werden. Der Begriff des Milieus als sozial prägende Kraft war fortan fest in der Soziologie etabliert. [2] [3] [10]
1900: Thorstein Veblen: das Milieu der Reichen
Für das Amerika der Zeit um 1900 untersuchte der US-Amerikaner Thorstein Veblen die Sitten der Reichen und zeigte, wie der klassengebundene Zwang zur Demonstration von Reichtum individuelle Charakterzüge überdeckte. Für Geld arbeiten zu müssen galt zur Zeit Veblens als Stigma [3]. Das soziale Milieu prägt damit sehr weitgehend das individuelle Verhalten. Siehe dazu den Artikel zum 👉 Veblen-Effekt
1935 und später: Fachkulturen als Milieus
Im Jahr 1935 veröffentlichte der polnische Arzt Ludwik Fleck ein kleines Buch über Wissenschaftler als Denkkollektive. [24] Spätestens begann sich die wissenschaftliche Forschung für Fachkulturen im Sinne von eigenen Milieus zu interessieren. Dabei prägen die Fachkulturen durch vielfältige Prozesse das Denken und auch das äußere Aussehen, den Habitus, ihrer Angehörigen, es findet also eine "Disziplinierung" statt [25], die sich stark dann auch die Außendarstellung der Fachkulturen prägt [26].
1960er Jahre: Pierre Bourdieu: Milieus im Alltag
Für die Länder Algerien und Frankreich der 1960er bis 70er Jahre führte der Franzose Pierre Bourdieu umfangreiche und detaillierte milieutheoretische Studien durch. Sie zeigen vor allem, wie sehr menschliches Verhalten und menschliche Vorlieben (Essen, Trinken, Kleidung, Wohnunseinrichtung) von ihrem jeweiligen sozialen Milieu abhängen [2]. Zu Bourdieus Gedanken siehe auch den Artikel 👉 Die feinen Unterschiede
2020: Die Milieutheorie in der Marktforschung
Die kommerziell arbeitende SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH greift Kerngedanken der Mileutheorie auf und macht sie unter anderem wirtschaftlich nutzbar. Die insgesamt zehn Sinus-Milieus fassen Menschen mit ähnlichen Werten und einer vergleichbaren sozialen Lage zu „Gruppen Gleichgesinnter“ zusammen. Im Jahr 2021 definierte das Institut für Deutschland die folgenden 10 Milieus. Die Prozentangaben stehen für den Anteil der Personen in diesem Milieu:
- 1) 11 %: Konservativ gehobenes Milieu
- 2) 12 %: Postmaterielles Milieu
- 3) 10 %: Milieu der Performer
- 4) 10 %: Expeditives Milieu
- 5) 10 %: Traditionelles Milieu
- 6) 11 %: Nostalgisch Bürgerliches Milieu
- 7) 12 %: Adaptiv Pragmatische Mitte
- 8) 8 %: Konsum-Hedonistisches Milieu
- 9) 8 %: Neo-Ökologisches Milieu
- 10) 9 %: Prekäres Milieu
Das Institut wirbt unter anderem damit, dass sogenannte "Milieu-Landkarten" dabei helfen, "Produkte, Marken, Parteien, Medien" zielgruppengenau zu platzieren. Das Institut bietet dazu Expertisen, Fortbildungen und Informationsmaterial an und ist auch an internationalen Forschungsprojekten beteiligt, wie zum Beispiel: a) Auswirkungen der Corona-Pandemie auf vulnerable Gruppen, b) Auswirkungen von Narrativen und Wahrnehmungen von Europa auf Migration, c) Best Practice-Umfrageinstrumente für die Musikindustrie.
Zwischen Selbstbestimmung und Funktionalität
Wo eine Milieutheorie so weit geht, alle wesentlichen Regungen eines Menschen ganz auf materielle [21] äußere Umstände zurückzuführen, erkennt sie dem Menschen einen freien Willen und jede Autonomie ab. Umgekehrt kann das Milieu aber auch Heimat und Verbundenheit stiften, im Sinne einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie die Ausbildung unterschiedlicher sozialer Milieus zu effektiven sozialen Strukturen innerhalb größerer Organisationen führen kann. [22]
Milieus und Arbeitsteilung
Maschinenbauer kleiden sich anders als Jurastudenten. Und Physiker [14] lachen über andere Witze als Politologen. Was zunächst nur wie eine oberflächliche Banalität aussieht hat aber einen tieferen Sinn und Zweck. In einem Buch aus dem Jahr 2004 werden die vier Hochschulfächer Physik, Biologie, Literatur und Geschichte als unterschiedliche Fachkulturen vorgestellt [8]. Dort heißt es: "Das Lernen einer Wissenschaft verlangt mehr von den Studierenden als nur das Lernen der »offiziellen Theorien« und Methoden. Denn die Identität einer Disziplin […] bildet sich nicht zueletzt durch ihre Traditionen und Brüche, ihre wissenschaftlichen Praktiken, sowie durch die moralischen Normen und Regeln des Verhaltens […]" [Seite 18]. Das macht Sinn, "Denn zu einer Wissenschaft […] werden die Forschungen erst, indem Gruppen von Forschern mit denselben paradigmatischen Modellen (und den mit diesem verbundenen Methoden und Argumentationsweisen) arbeiten, so dass ihre Ergebnisse sich letztendlich zu einer Wissenschaft verbinden [Seite 19]." Wichtig ist auch, dass "welcher Art das gesuchte Wissen ist [Seite 21]". Auch die als selbstverständlich anerkannten Kriterien von wahr und falsch unterscheiden sich in den Fächern stark: Literaturwissenschaftler würden zum Beispiel den »ästhetischen Geschmack« als Wahrheitskriterium gelten lassen, Geschichtswissenschaftler hingegen niemals. Für Physiker typisch sei das Experiment das wichtigste Wahrheitskriterium. In den Worten Pierre Bourdieus prägt der Wissenschaftler dann einen sozialen »Habitus« aus, der ihn für sein »soziales Feld« geeignet macht. Wenn Anfänger zu Mitgliedern einer Wissenschaftskultur werden, so durchlaufen sie eine Sozialisierung, ganz in Analogie zu der Differenzierung von biologischen Nerven wenn sie zu einem Teil eines Zellgewebes werden. Soziale Milieus festigen damit die gesellschaftliche Fähigkeit für eine 👉 Arbeitsteilung
Milieus als Katalsysator einer Soziogenese
Um das Jahr 900 vor Christus blühte im wüstenhaften Südwesten der heutigen USA plötzlich die indianische Chaco-Canyon-Kultur auf. Es entstanden große Städte mit aufwändig gebauten steinernen Gebäuden sowie eine komplexe Verkehrsinfrastruktur zur Einbindung weit entfernter Siedlungen. Was löste diesen kulturen Phasenwechsel von einer Stammesgesellschaft hin zu einer komplexen Stadtgesellschaft [23] aus? Die dort lebenden Indianer hatten schon viele Jahrhunderte vorher die Landwirtschaft eingeführt, sodass diese als allein auslösender Faktor nicht in Frage kommt. Der Komplexitätsforscher Roger Lewin vermutet, dass es die „Erfindung“ der Arbeitsteilung war [7]. Wenn sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen auf je eine bestimmte Tätigkeit konzentrieren, steigt dadurch die Effektivität der Gesellschaft als Ganzes möglicherweise sprunghaft an. Denkbar ist dann, dass eine soziale Differenzierung in Milieus auch eine arbeitsteilige Organisation gesellschaftlicher Aufgaben (Landwirtschaft, Militär, Verwaltung etc.) fördert und somit zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Gesellschaften wird. Die Arbeitsteilung wäre dann keine Folge einer städtischen Kultur, sondern eine ihrer Ursachen. Mehr zu diesem Beispiel steht im Artikel zur 👉 Chaco-Canyon-Kultur
Fußnoten
- [1] Hippolyte Taine (1828 bis 1893) habe eine gemeinsame Ursache aller Erscheinungsformen menschlicher Existenz gesucht: "Le but de Taine est de décrire l’ensemble des conditions d’existence d’une société de façon à saisir l’unité des causes qui le déterminent." Taine habe diese gemeinsame Grundursache menschlichen Verhaltens auf drei Begriffe gebracht "le milieu, la race et le moment" (Taine in: Histoire de la littérature anglaise, 1863). Der Einfluss des Milieus auf menschliche Verhaltensweisen sei jedoch bereits im 18ten Jahrhundert formuliert worden, doch sei es Auguste Comte (1798 bis 1857) zufolge Hippolyte Taine gewesen, der diese Idee als Definition im Sinne der Biologie oder Soziologie klar ausformuliert habe: "La théorie du 'moment' et du 'milieu', qui est capitale dans l’œuvre de Taine, n’était certes pas inconnue au xviiie siècle. Mais c’est Comte qui l’a généralisée en rapprochant Lamarck de Montesquieu: c’est lui qui a enseigné à Taine la définition générale, à la fois biologique et sociale, de l’idée de 'milieu'." Zitiert nach: Keck, Frédéric. « Chapitre 2. Races, cultures et mentalités ». In Lucien Lévy-Bruhl. Paris: CNRS Éditions, 2008. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.2065.
- [2] Armin H. Koller: Johann Gottfried Herder and Hippolyte Taine: Their Theories of Milieu. PMLA. 1912. Band 27, Seite 39.
- [2] Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Übersetzt von Bernd Schwibs und Achim Russer. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-518-57613-5. Siehe dazu 👉 Die feinen Unterschiede
- [3] Thorstein Veblen: The Theory Of The Leisure Class. 1899 (wörtlich: Die Theorie der müßigen Klasse); Übersetzung: Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen. Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1958. Neuauflagen: Fischer, 1997, ISBN 978-3-596-27362-1; 2007 ISBN 3-596-17625-5.
- [4] Julia Friedrichs: Gestatten: Elite. Auf den Spuren der Mächtigen von Morgen. Hoffmann und Campe Verlag. 2008.
- [5] Pierre Bourdieu. in: Extraits du film: Art et diffusion de masse. Produziert von Sylvie Nikitine und Jacques Rutman. 1973.
- [6] Milieutheorie. In: Spektrum Lexikon der Psychologie. Online. Abgerufen am 12. März 2023.
- [7] Roger Lewin: Die Komplexitätstheorie. Knaur Verlag. 1996. ISBN: 3-42-7190-X. Dort die Seiten 12 ff, 21, 33, 94 f. und 238 ff.
- [8] Markus Arnold, Roland Fischer (Herausgeber): Disziplinierungen: Kulturen der Wissenschaft im Vergleich. Verlag Turia und Kant. Wien. 2004. ISBN: 978-3851323900.
- [9] Jörg Rössel, Michael Hölscher: Soziale Milieus in Gaststätten: Eine Beobachtung. In: Sociologus 54, 2004, S. 173–203.
- [10] Den Einfluss der Umwelt auf die Ausbildung von menschlichen Rassen (weiße kaukasische Rasse, gelbe mongolische Rasse, schwarze äthiopische Rasse) wird diskutiert in: Edmond Villey: DE L'INFLUENCE DU MILIEU SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HOMME. Revue d'économie politique. Vol. 13, No. 1 (1899), pp. 18-29 (12 pages). Herausgegeben von: Editions Dalloz. Der Begriff der Rasse gilt heute als problematisch. Siehe mehr unter 👉 Rasse
- [11] Das Zitat zu den abgerichteten Menschen stammt aus: Julien Offray de la Mettrie. Die Maschine Mensch. 1784. Nach einer deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1875. Siehe dazu den Artikel 👉 Die Maschine Mensch
- [12] Auguste Comte: Einleitung in die positive Philosophie. Übersetzung von G.H. Schneider. Leipzig 1880, S 6f. Siehe auch 👉 Positivismus
- [13] Dass Taine in der Tat mechanistisch denkt, deutet eine Randnotiz in seiner Geschichte der englischen Literatur an: "Comment l'histoire est un problème de mécanique psychologique. Dans quelles limites on peut prévoir." In: Hippolyte Taine: Histoire de la Litterature Anglaise. Band I. Zweite überarbeitete Ausgabe. Paris. 1866.
- [14] Wie Laster und Tugend aus einfacheren Ursachen hervorgehen wurde hier aus dem französischen Original übersetzt: "Quand, dans un homme, vous avez observé et noté un, deux, trois, puis une multitude de sentiments, cela vous suffit-il, et votre connaissance vous semble-t-elle complète? Est-ce une psychologie qu'un cahier de remarques? Ce n'est pas une psychologie, et, ici comme ailleurs, la recherche des causes doit venir après la collection des faits. Que les faits soient physiques ou moraux, il n'importe, ils ont toujours des causes; il y en a pour l'ambition, pour le courage, pour la véracité, comme pour la digestion, pour le mouvement musculaire, pour la chaleur animale. Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre, et toute donnée complexe naît par la rencontre d'autres données plus simples dont elle dépend. Cherchons donc les données simples pour les qualités morales, comme on les cherche pour les qualités physiques, et considérons le premier fait venu; par exemple une musique religieuse, celle d'un temple protestant." In: Hippolyte Taine: Histoire de la Litterature Anglaise. Band I. Zweite überarbeitete Ausgabe. Paris. 1866.
- [15] "Trois sources différentes contribuent à produire cet état moral élémentaire, la race, le milieu et le moment."
- [16] Rasse wird charakterisiert als vererbte Neigung: "Ce qu'on appelle la race, ce sont ces dispositions innées et héréditaires que l'homme apporte avec lui à la lumière, et qui ordinairement sont jointes à des différences marquées dans le tempérament et dans la structure du corps. Elles varient selon les peuples." In: Hippolyte Taine: Histoire de la Litterature Anglaise. Band I. Zweite überarbeitete Ausgabe. Paris. 1866.
- [17] Das Milieu ist dann so viel wie die innere Struktur, in der die Angehörigen einer Rasse leben: "Lorsqu'on a ainsi constaté la structure intérieure d'une race, il faut considérer le milieu dans lequel elle vit." In: Hippolyte Taine: Histoire de la Litterature Anglaise. Band I. Zweite überarbeitete Ausgabe. Paris. 1866.
- [18] Zum Einfluss der Geographie auf das Gemüt der Völker schreibt Taine: "Quoique nous ne puissions suivre qu'obscurément l'histoire des peuples aryens depuis leur patrie commune jusqu'à leurs patries définitives, nous pouvons affirmer cependant que la profonde différence qui se montre entre les races germaniques d'une part et les races helléniques et latines de l'autre, provient en grande partie de la différence des contrées où elles se sont établies, les unes dans les pays froids et humides, au fond d'âpres forêts marécageuses ou sur les bords d'un océan sauvage, enfermées dans les sensations mélancoliques ou violentes, inclinées vers l'ivrognerie et la grosse nourriture, tournées vers la vie militante et carnassière; les autres au contraire au milieu des plus beaux paysages, au bord d'une mer éclatante et riante, invitées à la navigation et au commerce, exemptes des besoins grossiers de l'estomac, dirigées dès l'abord vers les habitudes sociales, vers l'organisation politique, vers les sentiments et les facultés qui développent l'art de parler, le talent de jouir, l'invention des sciences, des lettres et des arts." In: Hippolyte Taine: Histoire de la Litterature Anglaise. Band I. Zweite überarbeitete Ausgabe. Paris. 1866.
- [19] Mit Moment meint Taine einen bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte: "Quand le caractère national et les circonstances environnantes opèrent, ils n'opèrent point sur une table rase, mais une table où des empreintes sont déjà marquées. Selon qu'on prend la table à un moment ou à un autre, l'empreinte est différente; et cela suffit pour que l'effet total soit différent. In: Hippolyte Taine: Histoire de la Litterature Anglaise. Band I. Zweite überarbeitete Ausgabe. Paris. 1866.
- [20] Bestimmte Witze werden oft nur innerhalb ihres Milieus geteilt. Wer außerhalb eines Kreises von Physikern, würde den folgenden Witz unter Freunden erzählen: Kommt ein Neutron an einen Nachtclub Sagt der Türsteher: sorry, nur geladene Gäste.
- [21] Materiell heißt hier wenige stofflich-materiell im Sinne der Physik sondern eher dass ein Prozess geprägt ist durch eindeutige Gesetzmäßigkeiten. Da verschiedene Denkströmungen im 19ten Jahrhundert davon ausgingen, dass Materie im Gegensatz zu Geist oder Seele ganz nur nach Naturgesetzen funktioniere, steht Materialismus noch heute für die Idee eines ganz von Naturgesetzen determinierten Ablaufs der Welt. Siehe mehr dazu unter 👉 Materialismus
- [22] Ein größerer, spekulativer Rahmen ist die Idee sogenannter evolutionärer Transitionen, sprungartiger Höherentwicklungen von Gesellschaften. Auf verschiedenen evolutionären Stufen können als wiederkehrende Katalysatoren einer Höherentwicklung die Ausbildung von Arbeitsteilung und die Entstehung von Systemgrenzen ausgemacht werden. Ausreichend abstrakt gedacht können Milieus mit beiden diesen Phänomen in eine ursächliche Verbindung gebracht werden. Siehe dazu beispielhaft den Artikel zu einem gegenwärtig ablaufenden Evolutionssprung der Menschheit, der 👉 HMST [Human Metasystem Transition]
- [23] Die Bildung größerer menschlicher Gruppen hin zu staatsähnlichen Gebilden bezeichnet man auch als 👉 Soziogenese
- [24] Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Ersterscheinung bei Benno Schwabe & Co. in Basel. 1935. Siehe auch 👉 Ludwik Fleck
- [25] Wie Studenten an Hochschulen für bestimmte Fachrichtungen "diszipliniert" werden ist beschrieben in: Markus Arnold / Roland Fischer (Hrsg.): Disziplinierungen. Kulturen der Wissenschaft im Vergleich. Wien: Turia & Kant. 2004.
- [26] Auf die Fachbereiche Soziales, Technik und Wirtschaft einer Hochschule angewendet finden sich gut bebilderte und sehr konkrete milieutheoretische Betrachtungen in: Lisbeth Suhrcke: „Ich musste erstmal verstehen, wie ticken die hier, um was geht es?“ Fachkulturen an der Hochschule Emden/Leer. Schriftenreihe der Hochschule Emden/Leer, Band 30. 2020. ISBN 978-3-944262-20-8.