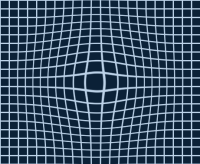Allgemeine Relativitätstheorie
Einführung
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Bedeutung|
Einführende Gedanken, Problemstellung|
Newton im Fahrstuhl|
Der egozentrische Apfel|
Gekrümmte Räume|
Fußnoten
Basiswissen
Die Allgemeine Relativitätstheorie aus dem Jahr 1916 gilt sowohl für zueinander gleichförmig bewegte Inertialsysteme wie auch für zueinander beschleunigte Inertialsysteme. Ein Inertialsystem ist gedanklich zunächst dasselbe wie ein Koordinatensystem. Sie ist damit allgemein[1]. Das wird hier kurz erklärt.
Bedeutung
Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie aus dem Jahr 1905 ist auf zueinander gleichförmig geradlinig bewegte Inertialsystem beschränkt. Damit kann man Raum- und Zektkoordinaten aus einem System in ein beliebiges anderes System umrechnen, sofern die Relativgeschwindigkeit der beiden Systeme zueinander bekannt ist. Nicht umrechnen kann man aber Raum- und Zeitkoordinaten, wenn die Systeme relativ zueinander beschleunigt werden. Das gelingt dann mit der allgemeinen Relativitätheorie.
Einführende Gedanken, Problemstellung
Newton im Fahrstuhl
Sowohl Albert Einstein als auch Arthur Stanley Eddington kannten waren mit der Materie vertraut. Einstein entwickelte die zentralen Gedanken der Theorie, Eddington stützte sie empirisch mit einer aufwändigen Beobachtung dazu, wie Sternenlicht von der Sonne abgelenkt wird. Um die grundlegende Fragestellung zu verdeutlichen, nutzen beide das Bild eines fallenden Fahrstuhls.[1][2]
Angenommen einige Physiker befänden sich in einem rundum geschlossenen Fahrstuhl der sich im freien Fall auf einen anderen Himmelskörper zu bewegt. Zu welchen Naturgesetzen würden die Forscher im Laufe der Zeit kommen? Sie würden zum Beispiel feststellen, dass ein Apfel, den man aus der Hand los lässt, nicht nach unten fällt. Er bleibt an der Stelle, an der man ihn losgelassen hat.[2] Dennoch würden die Forscher so etwas wie die Gravitationskraft entdecken, denn die Äpfel würden sich zwar schwach aber dennoch für gute Instrumente spürbar anziehen.
Der egozentrische Apfel
Sicht 1: eine seltsame Zugkraft
Ein anderes Gedankenexperiment geht auf Eddington zurück. Eddington zeigt, wie kein Bezugssystem gegenüber einen anderem bevorzugt werden kann. Er geht zunächst von Newtons Beobachtung aus, das ein Apfel von einem Baum herab nach unten falle. Newton sucht eine Ursache und sieht sie in einer ziehenden Kraft, einer Zugkraft (englisch: tug), die an dem Apfel wirkt.
Sicht 2: der Apfel löst das Mysterium
Nun wechselt Eddington in die Sicht des Apfels. Er wähnt sich in Ruhe und sieht, wie sich Newton immer schneller auf ihn zu bewegt. Der Apfel hat aus seiner Sicht sogar eine Erklärung für Newtons seltstames Verhalten: mit einem teleskopischen Mikroskop sieht er, wie die Moleküle des Erdbodens millionfach und mit hoher Geschwindigkeit auf Newtons Füße einhämmern. Damit hat der Apfel eine befriedigende Erklärung dafür gefunden, was Newton auf ihn, den Apfel zu beschleunigt.[3] Damit hat der Apfel für das Bezugssystem, in dem er in Ruhe ist, den Vorteil, einen plausiblen Grund für die Beschleunigung Newtons angeben zu können. Newton, für das System in dem er ruht, kann allerdings keine offensichtliche Kraft angeben, die den Apfel in Bewegung versetzt. Er muss deshalb auf die mysteriösen Zugkraft zurückgreifen.
Sicht 3: das Mysterium kommt zurück
Nun versetzt Eddington den fiktiven Newton in den Mittelpunkt der Erde. Dort gibt es keine Moleküle, nichts was auf Newton in eine bestimmte Richtung einhämmert. Wieder sieht Newton, wie der Apfel zur Erdoberfläche hin fällt, also auf ihn zu. Und wieder sieht der Apfel aus seiner Weltsicht, seinem Bezugssystem, wie sich Newton auf ihn zu bewegt. Aber dieses Mal kann er für die Bewegung Newtons keinen Grund mehr finden, denn die hämmernden Moleküle des Bodens wirken jetzt nicht mehr auf Newton, um ihn in eine bestimmte Richtung zu beschleunigen. Das Mysterium der Ursache ist zum Apfel zurück gekehrt. Er kann nichts besseres tun, als eine geheimnisvolle Zugraft anzunehmen.[4]
Sicht 4: Zugkräfte geben keinen Sinn
Nun haben wir also zwei gleich plausible Versionen: in einer ist Newton in Ruhe und der Apfel beschleunigt sich. In der anderen Version ist der Apfel in Ruhe und Newton beschleunigt sich. Keine der beiden Versionen ist richtiger als die andere. Dieser Punkt ist wichtig als Einstieg in die allgemeine Relativitätstheorie. Nun argumentiert Eddington, dass auch die Idee einer Zugraft, gemeint ist die Gravitationskraft, keinen Sinn gibt. Denn würde man dem Apfel eine Zugkraft zuordnen, würde man damit Newtons Bezugssystem bevorzugen. Und würde man die Zugkraft auf Newton wirken lassen, würde man unweigerlich das Bezugssystem des Apfels wählen.
ZITAT:
"Gravitation kann keine Kraft an einem Körper sein, denn wir bleiben im Unklaren, auf welchen Körper sie angewandt werden soll."[5]
"Gravitation kann keine Kraft an einem Körper sein, denn wir bleiben im Unklaren, auf welchen Körper sie angewandt werden soll."[5]
Die Kernidee der Relativitätstheorie ist es aber, dass man kein Bezugssystem bevorzugen kann - und es auch nicht tun will. Was ist dann die Lösung? Eddington zufolge benötigt man eine andere Sicht (we must picture it differently). Das ist der Ausgang hin zu einer gekrümmten Raumzeit.
Gekrümmte Räume
Im Zusammenhang mit Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist oft die Rede von einer gekrümmten Raumzeit. Wenn schon das Wort der Raumzeit Schwierigkeiten für eine anschauliche Vorstellung bereiten muss, so gilt das noch viel mehr für die Vorstellung eines gekrümmten Raumes oder einer gekrümmten Zeit. Eine Möglichkeit, sich einen gekrümmten Raum vorzustellen ist es, bei einer hypothetischen zweidimensionalen Welt zu beginnen, die in einem dreidimensionalen Raum existiert[6]: die Oberfläche der Erde wäre dann eine solche zweidimensionale Welt. Auf der weiten Fläche des Ozeans ist diese Welt wenig gekrümmt, auf dem Gipfel eines kleinen Hügels hingegen stark. Wie stark der Raum gekrümmt ist, kann man angeben über einen sogenannten Krümmungsradius.[7] Siehe auch gekrümmter Raum ↗
Fußnoten
- [1] Albert Einstein: Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Ersterscheinung: 1916. Eine sehr gute Einführung für jeden, der in etwa mindestens die Schulbildung eines guten Realschülers oder mittelmäßigen Abiturienten hat.
- [2] Eddington greift Einsteins Gedankenexperiment von einem Bewohner eines ewig fallenden Fahrstuhl auf. Für diesen hypothetischen Bewohner würde ein Apfel, den er aus der Hand los lässt, nicht nach unten fallen, sondern einfach neben der Hand schweben. Als Eddington diesen Gedanken niederschrieb, gab es noch keine Raumfahrt. Die Bewohner im Lift gibt es heute wirklich, nämlich etwa als Bewohner der Internationalen Raumstation ISS. Eddington, noch im Jahr 1928, schrieb über den damals noch hypothetischen Fahrstuhl-Bewohner: "I am crediting our observers in the lift with the usual egocentric attitude, viz. the aspect of the world to me is its natural one. It does not strike them as odd to spend their lives falling in a lift; they think it much more odd to be perched on the earth's surface. Therefore although they perhaps have calculated that to beings supported in this strange way apples would seem to have a perplexing habit of falling, they do not take our experience of the ways of apples any more seriously than we have hitherto taken theirs." Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort im Kapitel "Gravitation", Seite 112.
- [3] Das Bild, das Isaac Newton einen fallenden Apfel sah und dadurch einen zündenden Einfall zur Gravitationskraft bekam, ist in der Wissenschaft weit verbreitet. Eddington dreht die Sicht jetzt um und fragt: wie hätte der egozentrische (egotist) Apfel die Geschichte sehen können? "The Newtonian picture of gravitation is a tug applied to the body whose path is disturbed. I want to explain why this picture must be superseded. I must refer again to the famous incident in which Newton and the apple-tree were concerned. The classical conception of gravitation is based on Newton's account of what happened; but it is time to hear what the apple had to say. The apple with the usual egotism of an observer deemed itself to be at rest; looking down it saw the various terrestrial objects including Newton rushing upwards with accelerated velocity to meet it. Does it invent a mysterious agency or tug to account for their conduct? No; it points out that the cause of their acceleration is quite evident. Newton is being hammered by the molecules of the ground underneath him. This hammering is absolute—no question of frames of reference. With a powerful enough magnifying appliance anyone can see the molecules at work and count their blows. According to Newton's own law of motion this must give him an acceleration, which is precisely what the apple has observed. Newton had to postulate a mysterious invisible force pulling the apple down; the apple can point to an evident cause propelling Newton up." In: Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort im Kapitel "Gravitation", Seite 115.
- [4] "The case for the apple's view is so overwhelming that I must modify the situation a little in order to give Newton a fair chance; because I believe the apple is making too much of a merely accidental advantage. I will place Newton at the centre of the earth where gravity vanishes, so that he can remain at rest without support—without hammering. He looks up and sees apples falling at the surface of the earth, and as before ascribes this to a mysterious tug which he calls gravitation. The apple looks down and sees Newton approaching it; but this time it cannot attribute Newton's acceleration to any evident hammering. It also has to invent a mysterious tug acting on Newton. In: Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort im Kapitel "Gravitation", Seite 115.
- [5] We have two frames of reference. In one of them Newton is at rest and the apple is accelerated; in the other the apple is at rest and Newton accelerated. In neither case is there a visible cause for the acceleration; in neither is the object disturbed by extraneous hammering. The reciprocity is perfect and there is no ground for preferring one frame rather than the other. We must devise a picture of the disturbing agent which will not favour one frame rather than the other. In this impartial humour a tug will not suit us, because if we attach it to the apple we are favouring Newton's frame and if we attach it to Newton we are favouring the apple's frame. The essence or absolute part of gravitation cannot be a force on a body, because we are entirely vague as to the body to which it is applied. We must picture it differently". In: Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort im Kapitel "Gravitation", Seite 116.
- [6] Franz Serafin Exner: Grundlagen der Naturwissenschaften. Deuticke Verlag. 1919. Dort wird ab Seite 18 die Idee einer Raumkrümmung entwickelt. Ausgangspunkt ist das Krümmungsmaß K definiert als 1/rho, welches ursprünglich von Carl Friedrich Gauß eingeführt worden sei. Das kleine griechisch rho sei der Krümmungsradius, "das ist der Radius eines Kreises von gleicher Krümmung wie sie die Kurve an dem betreffenden Punkte besitzt". Exner lässt hier für rho auch den Wert unendlich zu, bei einem eindimensionalen Raum zu einer Gerade führt. Ist rho konstant (aber nicht unendlich), so entsteht ein Kreis. Für zweidimensionale Räume ergibt sich das Krümmungsmaß K als 1/(rho1 mal rho2). Rho1 und rho2 nennt Exner hier die Hauptkrümmungsradien. Sind sie beide unendlich groß, wird der zweidimensionale Raum zu einer "Ebene". Exner extrapoliert dann weiter in den dreidimensionalen Raum und definiert dessen Krümmungsmaß als 1/(rho1 mal rho2 mal rho3), und gesteht ein "Eine geometrische Vorstellung lässt sich damit freilich nicht mehr verbinden". Exner geht dann auf die geometrisch-physikalische Deutung spezieller Werte für K ein." Siehe auch gekrümmter Raum ↗
- [7] Ein Gleichnis zum Krümmungsradius der Raumzeit: 'We must try to reach the vivid significance which lies behind the obscure phraseology of the law. Suppose that you are ordering a concave mirror for a telescope. In order to obtain what you want you will have to specify two lengths (1) the aperture, and (2) the radius of curvature. These lengths both belong to the mirror—both are necessary to describe the kind of mirror you want to purchase— but they belong to it in different ways. You may order a mirror of 100 foot radius of curvature and yet receive it by parcel post. In a certain sense the 100 foot length travels with the mirror, but it does so in a way outside the cognizance of the postal authorities. The 100 foot length belongs especially to the surface of the mirror, a two-dimensional continuum; space-time is a four-dimensional continuum, and you will see from this analogy that there can be lengths belonging in this way to a chunk of space-time—lengths having nothing to do with the largeness or smallness of the chunk, but none the less part of the specification of the particular sample. Owing to the two extra dimensions there are many more such lengths associated with space-time than with the mirror surface. In particular, there is not only one general radius of spherical curvature, but a radius corresponding to any direction you like to take. For brevity I will call this the 'directed radius' of the world. Suppose now that you order a chunk of space-time with a directed radius of 500 trillion miles in one direction and 800 trillion miles in another. Nature replies 'No. We do not stock that. We keep a wide range of choice as regards other details of specification; but as regards directed radius we have nothing different in different directions, and in fact all our goods have the one standard radius, x trillion miles.' I cannot tell you what number to put for x because that is still a secret of the firm. The fact that this directed radius which, one would think, might so easily differ from point to point and from direction to direction, has only one standard value in the world is Einstein's law of gravitation.' In Arthur Stanley Eddington: The Nature of the Physical World. MacMillan, 1928 (Gifford Lectures). Dort im Kapitel "VII Gravitation - The Explanation". Die Seiten 140 und 141. Siehe auch Krümmungsradius ↗
- [8] Die allgemeine Relativitätstheorie gilt sowohl für Inertialsysteme (Koordinatensysteme), die zueinander beschleunigt sind als auch solche, die zueinander gesehen eine gleichförmige geradlinige Bewegung ausführen. Nur den letzten Fall alleine behandelt die spezielle Relativitätstheorie ↗
- [9] Albert Einstein: Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen. In: Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik IV. 1908, S. 411–462.
- [10] Albert Einstein: Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. In: Annalen der Physik. 35, 1911, S. 898–908.
- [11] Albert Einstein, Marcel Grossmann: Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. In: Zeitschrift für Mathematik und Physik. 62, 1913, S. 225–261.
- [12] Albert Einstein: Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. In: Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. 1915, S. 831–839.
- [13] Albert Einstein: Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. In: Annalen der Physik. Band 354, Nr. 7, 1916, S. 769–822.