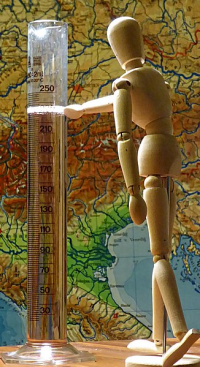Definition
≝ Genaue Beschreibung, was ein Wort meint
© 2016
- 2025
Basiswissen
Laut Duden heißt definieren „den Inhalt [eines Begriffes] auseinanderlegen, erklären“ oder „bestimmen, festlegen; angeben oder beschreiben, worum es sich handelt“. Definieren ist lateinischen Ursprungs und heißt wörtlich: aus einer Grenze herleiten, begrenzen. Mit einer Definition legt man einen (möglichst) genauen Bedeutungsinhalt, auch Begriff genannt, für ein Wort oder Zeichen fest.
Welche Arten der Definition gibt es?
Zu viele, um sie hier aufzulisten. Die einfachste Art der Definition ist das Zeigen: man kann zum Beispiel mit dem Finger auf eine Landkart zeigen und definieren: diese Bucht hier definiere ich als den Jadebusen. Man kann Begriffsinhalte auch dadurch definieren, dass man genaue Anleitung festlegt, anhand derer man festellen kann, welche Dinge unter den Begriff fallen und welche nicht. Ein Beispiel dafür ist etwa die Definition für einen 👉 Hochpunkt
Fußnoten
- [1] Den großen praktischen Nutzen einer guten Definition brachte der Physiker Max Planck im Jahr 1908 auf den Punkt: "Denn in der Schärfe und Zweckmäßigkeit der Definitionen und in der Art der Einteilung des Stoffs liegen, wie alles etwas tiefer Nachdenkenden bekannt ist, sogar die letzten, reifsten Resultate der Forschung häufig schon implizite mit enthalten." In: Die Einheit des physikalischen Weltbildes. (Vortrag, gehalten am 9. Dezember 1908 in der naturwissenschaftlichen Fakultät des Studentenkorps an der Universität Leiden.)
- [2] Wie Notwendig Definitionen sind, schrieb der Wegbereiter der heutigen Naturwissenschaften, Francis Bacon, 1620: "Die Götzenbilder, welche die Worte in den Geist einführen, sind zwiefacher Art. Entweder sind es Namen von Dingen, die es nicht giebt (denn so wie es Dinge giebt, die aus Unachtsamkeit keinen Namen bekommen haben, so giebt es Namen, wo die Philosophie getäuscht[105] und der Gegenstand fehlt), oder es sind zwar Namen von wirklichen Dingen, aber sie sind verworren, schlecht begrenzt, voreilig und ungleich von den Dingen entlehnt. Zur ersten Art gehören z.B. Worte wie: Glück; das erste Bewegliche; die Sphären der Planeten; das Element des Feuers und ähnliche Erdichtungen, die aus eitlen und falschen Lehren hervorgegangen sind. Diese Art von Götzenbildern kann leicht beseitigt werden; denn durch beharrliche Verleugnung und Beiseitschiebung solcher Lehren kann sie zerstört werden. Dagegen ist die zweite Art verwickelter und tiefer eingewurzelt, da sie aus schlechten und unvorsichtigen Abstraktionen entspringt. Wir wollen z. B. ein Wort wie Feucht nehmen und sehen, wie sich das mit diesem Worte Bezeichnete verhält; es wird sich dann zeigen, dass dieses Wort: Feucht nur das verworrene Zeichen verschiedener Wirksamkeiten ist, aus denen kein Bestimmtes ausgetrennt werden kann. Denn Feucht bezeichnet das, was in andere Körper sich leicht ergiesst; auch das, was in sich nicht fest und bestimmbar ist; auch das, was überall leicht nachgiebt; auch das, was sich leicht trennt und zerstreut; auch das, was sich leicht verbindet und sammelt; auch das, was leicht fliesst und beweglich ist; auch das, was einem andern Körper leicht anhängt und ihn benetzt; auch das, was leicht flüssig wird oder zusammenfliesst, während es vorher fest war. Man ist daher bei der Bildung und Beilegung dieses Wortes so verfahren, dass in dem Satze: die Flamme ist feucht, der Sinn des Wortes ein andrer ist als in dem Satze: die Luft ist feucht, und wieder ein andrer in dem Satze: der feine Staub ist feucht, und ein andrer in dem Satze: das Glas ist feucht. Hieraus erhellt, dass dieser Begriff nur von dem Wasser und den gewöhnlichen und bekannten Flüssigkeiten ohne die erforderliche Berücksichtigung voreilig entlehnt worden ist. Die Worte haben ihre Grade der Schlechtigkeit und der Falschheit. Die wenigst fehlerhafte Klasse bilden die für die Substanzen, namentlich für die untersten und gut abgeleiteten Arten; so ist der Begriff der Kreide, des Thones gut; der der Erde aber schlecht. Fehlerhafter ist schon die Klasse für die Vorgänge wie: Erzeugen, Verderben, Verändern. Am fehlerhaftesten ist die Klasse der Eigenschaften (mit Ausnahme der unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren), wie: Schwer, leicht, dünn, dicht u.s.w.; wobei natürlich diese einzelnen Begriffe je nach der Menge dessen, was den Sinnen der Menschen sich dargeboten hat bald besser, bald schlechter ausgefallen sind." In: Roger Bacon: on der ursprünglich auf sechs Teile geplanten Abhandlung hat Bacon nur den ersten und größere Abschnitte des zweiten und dritten Teils publiziert. Als erstes erschienen die zwei Bücher des zweiten Teils unter dem Titel »Instauratio Magna. Novum Organum, sive Indicia vera de interpretatione naturae«, London 1620. Die erste deutsche Übersetzung durch G. W. Bartoldy erschien unter dem Titel »Neues Organon«, Berlin 1793. Der Text folgt der Übersetzung durch Julius Heinrich von Kirchmann von 1870. Online: http://www.zeno.org/nid/20009151184