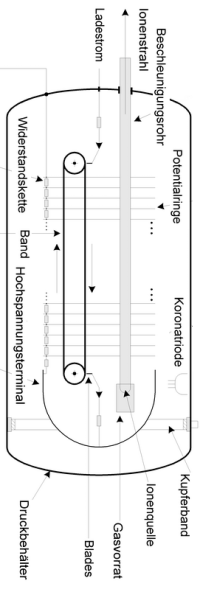Van-de-Graaff-Beschleuniger
… Elektrostatisch arbeitender 👉 Teilchenbeschleuniger
© 2016
- 2025
Basiswissen|
Basisfakten|
Spannungsaufbau|
Schutzgas|
Beschleunigung|
Berechnung|
Rechenbeispiel|
Rechentipps|
Tandem-Beschleuniger
Basiswissen
Ein Linearbeschleuniger, der vor allem für experimentelle Zwecke in der Physik eingsetzt wird. Beschleunigt werden meist Alphateilchen, Ionen oder Elektronen.
Basisfakten
- Der Van-de-Graaff-Generator ist ein 👉 Linearbeschleuniger
- Er wird fast ausschließlich in der experimentellen Physik verwendet.
- Beschleunigt werden meist Alphateilchen, Ionen oder Elektronen.
- Die Entwicklungsidee beruht auf dem 👉 Van-de-Graaff-Generator
- Maximale Spannungen von etwa 15 Millionen Volt sind möglich.
- Er wurde entwickelt um das Jahr 1930.
Spannungsaufbau
- Grundprinzip des Spannungsaufbaus wie bei einem 👉 Van-de-Graaff-Generator
- Ein nicht-leitendes Band bewegt sich schnell an Sprühelektroden vorbei.
- An beiden Enden des Bandes befinden sich spitze Metallelektroden.
- An dem einen Ende springen Elektronen vom Band auf die Elektroden.
- Das Band erfährt damit gegenüber der Umgebung ein Elektronendefizit.
- Das Band ist also gegenüber der Umgebung (Masse) positiv geladen.
- Am anderen Ende des Bandes läuft es an einer Metallkugel vorbei.
- Von der Metallkugel gehen ebenfalls spitze Elektroden zum Band.
- Es fließen Elektronen von der Metallkugel zum Band.
- Durch diesen Elektronenfluss wird das Band neutralisiert.
- Gleichzeitig verliert die Metallkugel dadurch Elektronen.
- Die Metallkugel wird also durch diesen Prozess positiv aufgeladen.
- Zwischen der Metallkugel und der Umgebung (Masse) sind je nach ...
- Bauweise Spannungen von mehreren Millionen Volt möglich.
Schutzgas
- Die Bauteile zur Erzeugung zur Hochspannung funktionieren auch in Luft.
- Aber: befindet sich Luft selbst unter hoher Spannung, kann es ...
- passieren, dass die Elektronen von Luftmolekülen abgerissen werden.
- Dadurch wird die Luft selbst plötzlich zu einem Leiter (Blitzeffekt).
- Daduch würde der aufgebaute Ladungsüberschuss von der Metallkugel abfließen.
- Es gibt Gase, bei denen dieser Effekt erst bei höheren Spannung als bei Luft auftritt.
- Man umgibt also die entsprechenden Bauteile eher mit solchen Gasen als mit Luft.
- Das ist der Grund, die Anordnung in einem geschlossenen Behälter unterzubringen.
Beschleunigung
- Beschleunigt werden immer elektrisch geladene Teilchen.
- Das können einzelne Elektronen, Alphateilchen oder Ionen sein.
- Die Beschleunigung erfolgt innerhalb einer evakuierten Röhre.
- Evakuiert meint: die Luft wurde entfernt, es herrscht quasi-Vakuum.
- Die Beschleunigungsröhre ist dabei meist mehrere Meter lang.
- Entlang der Röhre sind Metallplatten angelangt.
- Die oben beschriebene Spannung sollte möglichst ...
- räumlich gleichmäßig entlang der Röhre abfallen.
- Dazu wird die erzeugte Spannung kontrolliert auf die Platten verteilt.
- Diese Verteilung der Spannung hat auf die Endgeschwindigkeit keinen Einfluss.
- An einem Ende der Röhre wird dann ein Ion eingegegeben.
- Dieses wird dann entlang der Röhre beschleunigt.
- Am Ende der Beschleunigung prallt es auf irgendein Ziel.
- Werden ständig gelandene Teilchen erzeugt, entsteht eine Stromstärke.
- Mit der Bausweise sind Stromstärken von 10 bis 100 Mikroampere möglich.
- Ein Mikroampere ist ein millionstel Ampere.
Berechnung
- Von Interesse ist meist die Endgeschwindigkeit der Teilchen.
- Statt der Endgeschwindigkeit gibt man oft die Bewegungsenergie an.
- Man benötigt die Ladungsmenge Q des beschleunigten Teilchens.
- Man benötigt die Masse m des beschleunigten Teilchens.
- Man benötigt die gesamte Beschleunigungsspannung V.
- Ladung Q mal Spannung V gibt die Endenergie des Teilchens.
- Diese Endenergie ist gleich der Bewegungsenergie (kinetische).
- Sie kann angegeben werden in Joule oder Elektronenvolt.
- Über den Berechnungsterm für Ekin=½mv² kann man dann v berechnen.
- v wird angegeben in m/s oder einem Anteil der Lichtgeschwindigkeit c.
Rechenbeispiel
- Die gesamte Beschleunigungsspannung sei 10 MV.
- 10 MV meint 10 Megavolt, also 10000000 Volt.
- Beschleunigt werden soll ein 👉 Alphateilchen
- Es hat eine Masse von: 6,644 657 3357 mal 10^(-27) kg
- Es hat eine doppelt positive 👉 Elementarladung
- Die Ladung liegt also bei etwa: 3,204·10^(-19) C
- Spannung mal Ladungsmenge gibt Energie: 3,204·10^(-12) Joule
- Bewegungsenergie nach v aufgelöst gibt etwa: 31 Millionen m/s
- Das sind etwa 10 % der Lichtgeschwindigkeit c.
Rechentipps
Tandem-Beschleuniger
- Van-de-Graaff-Generatoren gibt es in zwei Varianten.
- Bei der einfachen Bauweise wird das Teilchen nur einmal beschleunigt.
- Bei einem Tandem-Beschleuniger wird es zweimal beschleunigt:
- Es wird zuerst künstlich negativ geladen.
- In diesem Zustand wird es zur positiven Ladung hin beschleunigt.
- Am Ende dieser Beschleunigung werden Elektronen vom Teilchen entfernt.
- Dadurch wird das Teilchen selbst positiv geladen.
- Es stößt sich dann gegenüber der Hochspannungselektrode ab.
- Diese Abstoßung ist dann der zweite Beschleunigungsvorgang.
- Wasserstoffatome können so bis zu 25 % der Lichtgeschwindigkeit erreichen.
- Siehe auch 👉 Lichtgeschwindigkeit